Magazin
Hochschul-News
Freiheit im Wandel
Vier Veranstaltungen der Leibniz Universität in Kooperation mit der Volkshochschule Hannover
weiterlesen
Erfolg für „Wissenschaftsräume: Institutionelle Grenzen überwinden“
Fördermillionen für Kooperationsvorhaben niedersächsischer Hochschulen
weiterlesen
Ausstellung für Forschung und Freiheit
Leibniz Science Cube gibt vom 15. Mai bis Dezember 2024 Einblicke in die Forschung an der Leibniz Universität Hannover
weiterlesen
CHE Hochschulranking
Studierende loben die Studienorganisation und fühlen sich optimal betreut
weiterlesen
Vier Veranstaltungen der Leibniz Universität in Kooperation mit der Volkshochschule Hannover
weiterlesen
Erfolg für „Wissenschaftsräume: Institutionelle Grenzen überwinden“
Fördermillionen für Kooperationsvorhaben niedersächsischer Hochschulen
weiterlesen
Ausstellung für Forschung und Freiheit
Leibniz Science Cube gibt vom 15. Mai bis Dezember 2024 Einblicke in die Forschung an der Leibniz Universität Hannover
weiterlesen
CHE Hochschulranking
Studierende loben die Studienorganisation und fühlen sich optimal betreut
weiterlesen
Die besondere Dozentin: Ann Cotten | Zurück
Ann Cotten wurde 1982 in Iowa, USA geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Wien und studierte dort Deutsche Philologie. Sie schloss ihr Studium mit einer Arbeit über die Konkrete Poesie ab, die später als Buch veröffentlichte wurde. Schon früh widmete Cotten sich Poetry Slams, Gedichten, Prosatexten sowie Rezensionen und veröffentlichte erste Texte in Literaturzeitschriften und Anthologien. 2007 erschien ihr erster Gedichtband „Fremdwörterbuchsonette“, der mittlerweile mehrfach preisgekrönt wurde. Heute arbeitet sie als Schriftstellerin sowie Übersetzerin und veröffentlicht zudem literaturjournalistische Beiträge. Besonders geschätzt werden sie und ihre Arbeit für die einzigartigen spielerischen Sprachexperimente, die Überschreitungen und Verschiebungen von Grenzen zwischen Bedeutungen und Genres innerhalb ihrer Texte und die berührenden Themen.Im Jahr 2020 promovierte sie noch in Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin und lebt heute im Wechsel in der deutschen und der österreichischen Hauptstadt, wo sie die Zeitschrift „Triëdere – Zeitschrift für Theorie, Literatur und Kunst“ herausgibt. 2021 erhielt sie den Gert-Jonke-Preis. Im März 2023 veröffentlichte sie „Die Anleitung der Vorfahren“. „Einfach große Literatur“, urteilte die ZEIT.
Im Wintersemester 2023/24 wird Ann Cotten die zweite Poetikdozentur an der Leibniz Universität Hannover übernehmen. Die Hannoversche Poetikdozentur wurde vom Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik am Deutschen Seminar an der Leibniz Universität Hannover und dem Literaturhaus Hannover ins Leben gerufen. Sie wird gefördert von der VGH Stiftung und aktiv begleitet von Studierenden des Fachmasters Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Ausgewählt wird der*die Dozent*in durch eine Jury die, nach Vorgängerin Lena Gorelik im Wintersemester 2022/23, nun also Ann Cotten auswählte. Die Idee zu dieser bundesweit einzigartigen Dozentur ist, gesellschaftliche Transformationen und eine Gesellschaft der Vielen auch in einer Literatur der Vielen sichtbar zu machen. Dabei ist nicht die Identität der Autor*innen ausschlaggebend, sondern allein die Frage, ob ihr Schreiben die Realität einer postmigrantischen Gesellschaft adressiert.
Wie sind Sie dazu gekommen, die Poetik-Dozentur für das kommende Semester zu übernehmen?
Wie das so ist – ich wurde gefragt. Ich war schon hin und wieder im Literaturhaus. Das heißt, ich denke mir, dass man mich deswegen kannte. Und vielleicht wegen des Adelbert-von-Chamisso-Preises. Das ist ganz interessant, den gab es lange für deutschsprachige Werke von Autor*innen, die nichtdeutscher Sprachherkunft sind. Und komischerweise, nachdem ich den bekommen hatte, wurde er im nächsten Jahr abgeschafft. Mit dem Argument, dass er nicht mehr notwendig sei. Also ist es jetzt wohl ganz normal, dass Leute auf Deutsch schreiben, auch wenn sie nicht hier geboren sind. Ja, leuchtet ein. Trotzdem war ich ein bisschen geschockt, dass der abgeschafft wurde, weil ich es wichtig finde, das weiterhin zu fördern. Ich finde es einerseits gut, dass der Fokus mehr auf die Sprache oder die Textarbeit gelegt wird und weniger auf den migrantischen Hintergrund. Aber andererseits darf man den Hintergrund hinsichtlich Diskriminierung nicht aus dem Blick verlieren. Es geht schon auch darum zu fragen, ob Leute benachteiligt werden und ob die Kultur sich nicht stärker verändern müsste, um die Wirklichkeit abzubilden. Oder sie wenigstens auf dem Schirm zu haben. Ich bin neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Das kommt ja aus der Germanistik, dass der Fokus mehr auf die Texte und nicht auf die Biografie gelegt werden sollte. Und darüber haben sich die Autor*innen, die verschiedene Preise für Literatur mit migrantischem Hintergrund bekommen haben, zu Recht beschwert. Dass sie auf ihre Biografie reduziert werden. Das sollte nicht passieren. Aber gleichzeitig finde ich dennoch wichtig, dass nicht vergessen wird, dass Hautfarbe oder Habitus eine wichtige Rolle spielen.
Was bedeutet diese Poetikdozentur für Sie persönlich? Ist das jetzt Neuland?
Man wird als Autorin schon öfter nach Poetik gefragt. Ich war zum Beispiel vor drei Jahren in New York als Poetikdozentin eingeladen, vor Corona. Es häuft sich manchmal sogar ein bisschen. Und es gab eine Zeit, da hat es mich auch etwas genervt, die ganzen Poetiken von den Autor*innen zu hören. Manchmal wird es auch so apologetisch. Aber hin und wieder danach gefragt zu werden, finde ich dann eigentlich doch eher produktiv, weil man auch andere Antworten hat zu anderen Zeitpunkten. Und gerade im postmigrantischen Kontext ist das ein Begriff, der irgendwie neu oder noch nicht fest definiert zu sein scheint. Das hat sicher was mit Mehrsprachigkeit zu tun – und auch Mehrsprachigkeit als Selbstverständlichkeit. Das interessiert mich heute mehr, als es mich früher interessiert hat. Da gehörte ich zu den Leuten, die gesagt haben, kein Problem, es ist nicht meine Muttersprache, aber ich komme perfekt zurecht. Ich brauchte auch diesen Anstoß durch solche neuen Fragestellungen, um darüber zu reflektieren, dass das auch bei mir eine vielleicht stärkere Rolle spielte als ich selbst dachte.
Wie unterscheidet sich so eine Poetikdozentur von einer konventionellen Professor*innenstelle?
Ich sehe mich als relativ frei, was für jemanden wie mich natürlich ein Vorteil ist. Ich habe keinen Lehrplan. Ich kann selbst eine Art Kanon mitbringen, einen alternativen Kanon. Das ist für mich eine Chance, möglichst radikal zu sein. Zu fragen, was hat man im Blick, wenn man an Poetik denkt. Oder an Literatur denkt, usw. Mich interessieren auch Songtexte oder nichtsprachliche Poetik. Welche Rolle spielt das? Ich komme von außen und kann darum auch experimentelle Fragen stellen. Und ich hoffe, dass wir auch in einen Dialog kommen hinsichtlich der sich sehr schnell erneuernden Medien und Kommunikationsformen. Dass die Leute jetzt schon fast im Jahrestakt unterschiedliche Chat-Medien nutzen. Es gibt andere Rhythmen. Und gerade in der Lyrik kann man schon sehen, dass es einen Einfluss hat, wenn Leute wichtigste Beziehungen über Chats navigieren. Und dazu finde ich in dem Zusammenhang auch den Dialog zwischen den Generationen interessant. Was macht das mit Text? Was macht das mit der Rezeption? Es ist zum Beispiel sicher nicht so, dass die Leute weniger lesen, sie lesen nur weniger in Büchern, was aber vielleicht auch nicht stimmt.
Die Poetikdozentur steht unter dem Motto „Neue Schreibweisen in einer diversen und postmigrantischen Gesellschaft“. Übernehmen Sie dieses Motto oder unter welchem Motto führen Sie ihre kommende Dozentur?
Ich finde mich schon in diesem Motto. Die neuen Schreibweisen sind ein gutes Stichwort. Wie könnten die sein? Wie könnten die klingen? Und welche Publikationsformen finden sich? Wie gesagt, die ephemeren Formen wie Chats sind ja durchaus auch Medien für Poesie, wenn sie dazu zweckentfremdet werden. Das finde ich nicht uninteressant. Auch Musik. Tech House. Eric D. Clark hat in den 90er-Jahren in seinen Mixes oft sehr berührende Textzeilen, sehr poetische Motive. Das passt sehr schön rein bei mir. Was passiert in so einem Setting mit so einer Textzeile? Im Nachtleben, im Unterbewusstsein. Das geht ganz weit weg von dem, was man sich so vorstellt, was man unter Lyrik versteht oder der Lektüre eines Buches.
Also ganz neue Formen der Sprache. Steht dafür auch „Text Fur Aliens“, der Titel Ihrer Antrittsvorlesung und des Blockseminars? Oder was hat es damit auf sich?
Ja, dieses „Fur“ ist das Zitat von Full Dancefloor und das bezieht sich auf diese mit Fell bedeckte Tasse von Meret Oppenheim. Man kann sich schwer vorstellen, auf einer befellten Tanzfläche zu tanzen. Nur so ein Einfall. Text Fur Aliens hat einerseits diesen fehlenden Umlaut, quasi ein Fehler oder Aussprachefehler, der markiert ist. Der als Reiz benutzt wird und als Wortspiel. Mich interessieren Wortspiele, das ist ein Element. Fur Aliens stellt für mich sprachtechnisch eine interessante Frage: Wie schreibt man für etwas ganz anderes, für Wesen, die man sich gar nicht vorstellen kann?
Ich bin bei der Recherche für dieses Interview auf das „polnische Gendering“ gestoßen. Wird es dazu auch irgendwas geben? Bzw. was ist das überhaupt?
Das wird sicher immer wieder zur Sprache kommen. Das ist meine Variante einer von mir erwünschten Vielfalt beim Gendern. Es funktioniert so, dass alle für alle Gender notwendigen Buchstaben in gefälliger Reihenfolge ans Ende kommen. Und es wurde Polnisch genannt, um den Verdacht auf Political Correctness zu zerstreuen. Aber auch wegen der polnischen Reihung beim Coding. Dass das nicht unbedingt die für Menschen optimierte Reihenfolge ist, sondern die Maschine ist in der Lage, sich das so zu holen, wie sie es braucht. Aber eigentlich sind wir auch dazu in der Lage. Man kennt ja dieses Spiel, dass bei Worten die Buchstaben in der Mitte vertauscht sind. Das hindert nicht unbedingt. Man nimmt die Gestalt des Wortes wahr beim Lesen und somit verschwindet zum Beispiel auch der kategorische Unterschied zwischen Kanji und alphabetischer Schrift. Kanji hat sozusagen Schriftzeichen. Und im Fall von Japanisch noch zusätzlich Grammatik in Hiragana. Es hieß immer, es seien Ideogramme, man nehme den Sinn zuerst war. So ganz stimmt das aber nicht. Es ist ein bisschen komplizierter aber dann gar nicht so unterschiedlich zur Alphabetschrift. Man nimmt ja auch die Gestalt wahr, beispielsweise des Wortes „elf“. Und nur, wenn man das auf den ersten Blick nicht erfasst, dann erst liest man „nullfünfelf“. Ich finde es interessant, mit so einer phänomenologischen Sichtweise hinzuschauen. Was passiert kognitiv beim Lesen? Dann verschwinden Unterschiede, die zuerst kategorisch wirken.
Ich schätze, sie werden zum „polnischen Gendering“ noch einige Fragen bekommen.
Es gibt in Österreich auch das Entgendern nach Phettberg, das mir ebenfalls gut gefällt. Da ist man dann Autory, da ist einfach ein „y“ angehängt und es wird sächlich benutzt. Das Autory, das Study, das geht gut, bis es zu den Opfery kommt. Das kann dann ein bisschen zu lustig sein. Ich habe eine Zeitschrift übernommen in Wien. Wir sitzen zu dritt in der Redaktion und wir schmeißen alles einfach wild durcheinander, sogar im Vorwort. Mal so, mal so, einfachheitshalber. Ich find Normen schon gut. Also wenn das jetzt so ein bisschen standardisiert wird. Beim Gendern ist die Realität aber noch so durcheinander, da bringen die Normen noch nichts. Ich glaube, es ist besser, wenn möglichst viel ausprobiert wird.
Arbeiten Sie eigentlich lieber auf Deutsch oder auf Englisch oder Japanisch oder Hawaiianisch …?
Naja, ich brauche schon eine gewisse Kompetenz. Ich bin im Japanischen zum Beispiel nicht so weit, dass ich selbst schreiben würde, außer irgendwelche scherzhaften Experimente. Englisch und Deutsch halten sich so die Waage. Immer wenn ich von der Sprache umgeben bin, dann ist es naheliegend, auch in der Sprache zu schreiben. Da kommen ja auch so Wortfetzen von der Straße usw., die sich von allein quasi ins Gehirn bohren und sich da aktiv machen. Ich merke jedes Mal, wenn ich in einem anderen Land bin, dass das einen Schub gibt, dass das einen Lerneffekt hat, dass eine Verfeinerung der Erfahrungswelten stattfindet. Sehr spannend.
An „Die Anleitung der Vorfahren“ haben Sie in Hawaii gearbeitet. Können Sie kurz erzählen, worum es geht in dem Buch?
Man könnte sagen es ist eine Art Crossroads. Ich war in Hawaii, weil ich an der Uni zu Gast war, ich habe dort bei einem Professor studieren dürfen, der sich einerseits für amerikanischen Pragmatismus und andererseits auf die Kyōto-Schule spezialisiert hat. Das war beides für mich sehr spannend. Einerseits, weil ich Philosophie nicht studiert habe, aber immer wieder auf die Fragen komme. Und dann zu sehen, wie sie arbeiten, wie die Philosophen im Gegensatz zu den Germanisten eher mit Ideen arbeiten. Und dabei auch manchmal sehr hemdsärmelig vorgehen. Der Professor hatte ein extrem feines sprachliches Besteck, und zwar in einem fast betont nicht muttersprachlichen Englisch. Er nutzt die Möglichkeiten und geht sehr skeptisch, aber auch spielerisch mit Idiomatik um. Das ist das, was mich eigentlich ursprünglich fasziniert hat, mich motiviert hat, mich gerade an ihn zu wenden. Und daneben habe ich mich auf seine Empfehlung hin gefragt, ob ich beim Hawaiianisch-Kurs mitmachen sollte. Was dann extrem toll war. Der Kurs konnte mir auch in Bezug auf den Status von Metaphern sehr tiefe und beeindruckende Seiten von Sprache zeigen. Die Lehrerin hat im Rahmen des Sprachunterrichts erklärt, dass Metaphern anders zu denken sind, dass es verschiedene Denotationsbereiche der Wörter gibt, die sich aufeinander beziehen. Aber es ist nicht so, dass der eine Bereich dominant ist und auf den anderen als Metapher übertragen wird. Die beiden wörtlichen Bedeutungen verknüpfen sich und das geschieht oft in verschiedenen Domänen, zum Beispiel in der göttlichen oder spirituellen Sphäre und dann in der alltäglichen, banalen, konkreten Sphäre. Das verknüpft die Welt auf eine Weise, die für mich poetische Sprache ausmacht. Das fühlte sich extrem richtig an! Als würde man die Vorlage finden, nachdem man vorher nur eine Kopie gekannt hat. Das zu finden, dass das als Selbstverständlichkeit, als selbstverständliche Eigenschaft der Sprache gehandelt wird, und nicht als Sonderausgabe der Dichtung, das war spannend.
Zurück zur Lehre – Sie waren bislang noch nicht so häufig in der Position der Dozentin. Haben Sie einen besonderen Anspruch an Ihre Lehre? Was erwartet die Studierenden?
Ehrlich gesagt will ich es einfach besser als früher machen. Ich hatte nie besondere Lust, andere zu unterrichten. Ich bin immer an dem interessiert, was mich gerade interessiert. Ich entdecke gerne. Aber ich mag nicht anderen Leuten sagen, was sie denken sollen. Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass anderen Leuten dasselbe gefallen soll wie mir. Darum fällt es mir zum Beispiel leichter, normalen Sprachunterricht zu geben als Lyrik zu unterrichten, wo ich geschmäcklerisch bin. Im Fall dieser Dozentur glaube ich, dass es Themen gibt, bei denen man sich einfach gemeinsam Texte anschauen und darüber sprechen kann. Und dass auch die materialistische Poetik eine Folie bietet oder ein Thema bietet, über das man gut sprechen kann. Die Frage der ästhetischen Bewertung kann derweil ein bisschen ruhen, wir lassen die Geschmäcker ein bisschen in Ruhe.
Hätten Sie sich selbst eine Poetikdozentur gewünscht, als Sie noch studiert haben? Hätte Ihnen das geholfen?
Es war immer spannend, wenn wir Autor*innen zu Gast hatten, sogar wenn sie sich arrogant verhalten haben. Es ist einfach spannend, wenn Leute sich auf so eine extreme Art seit Jahren mit Texten befassen und davon erzählen. Weil das immer sehr unterschiedlich ist. Und auch die Leute sehr unterschiedlich sind. Manche geben Empfehlungen, manche sind sehr politisch, quasi aktivistisch drauf, was ich cool finde, aber selbst nicht so ganz leisten kann. Ich bin eher nachdenklich. Ich schreibe zwar auch literatur-journalistische Texte, aber ich muss zugeben, dass das wenig ist. Ich würde gerne mehr schreiben, aber ich bin auch so langsam reflektierend, dass ich im Tagesgeschäft nicht so richtig dabei sein kann.
Ihre Vorgängerin war Lena Gorelik. Kennen Sie sich? Und haben Sie verfolgt, was sie als Poetikdozentin hier erarbeitet hat? Was machen Sie anders oder gleich?
Ich habe mir online angehört, was dort zu hören ist, nachdem ich eingeladen wurde. Und ich habe sie neulich in Stuttgart kennenlernen dürfen. Wir haben uns gut unterhalten. Wir sind, glaube ich, was den Schreibansatz betrifft, sehr unterschiedlich. Insofern wird es nicht eine Weiterführung oder Ergänzung. Ich wäre eigentlich neugierig, was Sie genau mit den Student*innen gemacht hat. Aber andererseits ist es vielleicht auch gut, jetzt einfach was Neues zu machen. Vielleicht ist es dann ja auch ähnlich.
Unser Format hat ja die Überschrift „Die besondere Dozentin“. Was würden Sie sagen, was macht Sie zu der besonderen Dozentin?
Dass ich nicht immer hier bin (lacht).
Zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen: Was lesen Sie gerade?
Ich kann es gerne einmal zeigen. Das ist von Shino Masataki. Da brauche ich lange, mich durchzuarbeiten. Es heißt „Post-Anthropozän. Environmental Philosophy. Eine Ergologie der Komplexität“. Dabei fasst er so Leute wie Timothy Morton und viele andere zusammen und bringt sie in Verbindung mit japanischen Philosophien. Das ist auf Japanisch geschrieben. Und ich lese Volker Braun, „Hinze-Kunze-Roman“ und „Berichte von Hinze und Kunze“. Ich bin noch ein ziemlicher Fan und eigentlich müsste ich an seinem Denken beim Techno recherchieren. Ein bisschen, weil er immer wieder auf den Rausch der Arbeit kommt, als Urerlebnis seiner frühen Studienzeit. Also eben nicht die Studienzeit. Er wurde eingeteilt, im Braunkohle-Kohlerevier mitzuarbeiten und schreibt immer wieder davon. Wie es ihn beeindruckt hat, dass Leute in so einen Arbeitsrausch kommen. Einerseits in eine totale Euphorie und andererseits in eine totale Abstumpfung. Das ist zum Teil das zentrale Motiv für seinen Ansatz, immer wieder darauf zu pochen, dass im Sozialismus die Leute mitreden müssen. Er hat da viel interne Kritik geübt. Und zugleich steht er in beiden Richtungen. Er hat sich niemals vom Westen als Dissident vereinnahmen lassen. Er galt im Westen immer als regimetreu. Und umgekehrt. Intern hat er kritisiert am Rand des Publikationsverbots. Eine sehr spannende Figur. Ein toller Dichter. Gerade diese Berichte von Hinz und Kunz.
Haben Sie sonst ein*e Lieblingsautor*in oder ein Lieblingsbuch, was Ihnen sofort in den Kopf kommt?
„Always crashing in the same car“ von Annette Pitsch, fast unlesbar. Es geht um Lacan, die Mathematik Lacans, in informatischer Sprache. Es ist irre.
Letzte Frage: Warum tun Sie das, was Sie tun?
Aus Obsessivität (lacht). Sprache ist ein riesiges Medium, und es kommt mir sehr effizient vor, daran zu schrauben.
>> Interview: Andra Vahldiek
Zurück





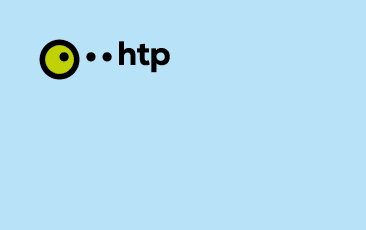



.jpg)



