25.03.2024: Mit salztoleranten Pflanzen gegen die Folgen des Klimawandels
.
Gourmets schätzen die Spitzen der Pflanze, sie schmecken nach Meer. Doch bislang fristete Queller – auch Meeresspargel genannt – eher ein Nischendasein. Für die industrielle Massenproduktion von Lebensmitteln wird die Pflanze, die auf Salzwiesen oder im Watt wächst, bislang nicht genutzt. Dabei haben Pflanzen wie der Europäische Queller (lat. Salicornia europaea) viele Qualitäten – das ist das Ergebnis des europaweiten Forschungsprojekts Aquacombine, in dem sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr als vier Jahre lang mit dem Potenzial von Halophyten, das heißt von weitgehend salztoleranten Pflanzen, befasst haben. So dient Queller nicht nur als Nahrung, sondern verfügt über wertvolle Polyphenole, kann als Filter in salzhaltigem Wasser eingesetzt werden und trägt darüber hinaus durch sein Wurzelwerk maßgeblich zum Küstenschutz bei.
Die Europäische Union hat das Forschungsvorhaben innerhalb des Programms Horizon 2020 mit zwölf Millionen Euro gefördert. Das Institut für Botanik an der Leibniz Universität Hannover (LUH) war unter Leitung von Prof. Dr. Jutta Papenbrock als einer von 17 Projektpartnern dabei. Die Gesamtleitung lag bei der Aalborg University, Dänemark. Das Ziel: herauszufinden, ob und inwiefern sich die Eigenschaften der Pflanze nutzen lassen, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, und ob es möglich ist, eine Nutzungskette mit hoher Wertschöpfung aufzubauen.
Eine der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist die Deckung des weltweiten Bedarfs an nachhaltig erzeugter Biomasse, sowohl für die Ernährung von Mensch und Tier als auch für den immer wichtiger werdenden Sektor der Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Unmittelbar damit verbunden sind ein steigender Süßwasserbedarf für die Landwirtschaft und der Verlust von Ackerland aufgrund von Versalzung.
Salicornia europaea und verwandte Arten werden in der EU wegen ihrer frischen Spitzen, die als Gemüse gegessen werden, bislang nur in einigen wenigen Regionen in kleinem Maßstab kommerziell angebaut. Sie zählt – genau wie die ebenfalls untersuchten Pflanzenarten Strandaster (Tripolium pannonicum) und Meeresfenchel (Crithmum maritimum) – zu den sogenannten Halophyten, das bedeutet, diese Pflanzen sind tolerant gegenüber Salzwasser. Aufgrund dieser besonderen physiologischen Eigenschaften und biochemischen Zusammensetzung sind Halophyten eine für verschiedene Studien und biologische Anwendungen interessante Pflanzengruppe.
Das Interesse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der LUH galt zunächst dem Potenzial der Pflanzen als Kulturpflanze. Der Vorteil gegenüber nicht salztoleranten Arten liegt dabei auf der Hand: Halophyten brauchen kein Süßwasser und wachsen an Küsten oder in Salzwüsten, also auch dort, wo andere Pflanzen nicht gedeihen. Dabei benötigt die Pflanze wenig Platz. Versuche am Institut für Botanik der LUH mit einer eigens aufgebauten Pilotanlage zeigten, dass die Aufzucht auch in einem Gewächshaus mit Kunstlicht möglich ist und dass sich der Ertrag unter günstigen Bedingungen, wie einer optimalen Salzkonzentration in der Nährlösung, erheblich steigern lässt, was langfristig für die Produktion von Queller in großem Umfang wichtig wäre. Hinzu kommt, dass gerade Salicornia nicht nur schmackhaft ist, sondern auch gesund: Die Pflanze ist reich an Polyphenolen, diese wirken antioxidativ und entzündungshemmend.
Aber Halophyten können noch mehr. Im Institut für Botanik hat Andre Fussy, Doktorand im Team von Prof. Dr. Papenbrock, mithilfe molekularbiologischer Techniken das Geheimnis der außergewöhnlichen Salztoleranz des Europäischen Quellers näher untersucht. Wie so oft liegt die Antwort in den Genen der Pflanze. Einerseits könnten sie es in Zukunft ermöglichen, andere Pflanzen wie Tomaten so zu verändern, dass sie besser mit salzigen Böden zurechtkommen. Andererseits können die Untersuchungen auf molekularer Ebene dazu beitragen, Queller schneller als Nutzpflanze zu etablieren.
Daneben untersuchten andere an Aquacombine beteiligte Partner, ob es machbar ist, die Bewässerung an eine Fischkultur zu koppeln, da die Pflanzen auf diese Weise die Nährstoffe aus der Fischkultur filtern und wiederverwenden können. Auch die Phytoremediation – das heißt ein möglicher Einsatz zur Regeneration salzhaltiger Böden – war Thema des Projekts. Insgesamt hat Aquacombine dazu beigetragen, neue stresstolerante Pflanzen im Sinne der Bioökonomie nutzbar zu machen.
.
20.02.2024: Leibniz Universität Hannover und Leuphana erhalten rund 1,3 Millionen Euro für Recyclingforschung an Fahrzeugteilen
.
Haltegriffe, Kofferraumabdeckungen und Mittelkonsolen: Viele Fahrzeugteile sind aus Kunststoff gefertigt. Gegenüber Metall hat dies viele Vorteile – unter anderem ist Kunststoff deutlich leichter, was sich nicht zuletzt auf den Treibstoff- und Energieverbrauch von Autos positiv auswirkt. Die Entsorgung bzw. die Rückführung von Kunststoffen in den Wertstoffkreislauf gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger, nicht zuletzt, weil die einzelnen Fahrzeugteile aus unterschiedlich zusammengesetzten Kunststoffkomponenten bestehen.
Ein neues Forschungsvorhaben am IKK – Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik der Leibniz Universität Hannover (LUH) strebt unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hans-Josef Endres erstmals einen Vergleich der gängigen Recycling-Methoden an. Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „REMOTIVE - Zirkularität mit recycelten und biogenen Rohstoffen“ vier Jahre lang mit insgesamt 1,3 Millionen Euro. Projektpartner sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg, unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Kümmerer.
Aktualität gewinnt das Forschungsvorhaben zudem durch die Pläne der Europäischen Union zu einer Verordnung, die die Verwertung von Altfahrzeugen neu regeln soll. Demnach sollen ab dem Jahr 2030 bei neuen Fahrzeugen mindestens 25 Prozent aller Kunststoffbauteile aus Rezyklat bestehen – davon sollen wiederum mindestens 25 Prozent aus Alt-Fahrzeugen stammen. Künftig bestehen also mehr als sechs Prozent aller Kunststoffbauteile eines Autos aus alten Automobilbauteilen.
Beim Recycling von Kunststoffen gibt es drei übergeordnete Verfahren: die chemischen, die lösungsmittelbasierten und die mechanischen. Allen drei Recyclingmethoden ist gleich, dass die Kunststoffe vorher möglichst sortenrein getrennt werden müssen, um qualitativ hochwertiges Rezyklat zu erhalten. Dies ist vergleichsweise aufwendig, aber notwendig, denn viele Bauteile, wie etwa eine Mittelkonsole, bestehen nicht nur aus unterschiedlichen Kunststoffen, sondern aus vielen verschiedenen Kunststoffkomponenten und zusätzlich noch aus anderen Materialien wie Metall, Faserverbundwerkstoffen oder Klebstoff. Da die Kunststoffe in Fahrzeugen meist schwarz sind, fällt eine Trennung per gängigen spektroskopischen Verfahren aus, denn aufgrund der eingesetzten Farbstoffe werden die Teile nicht richtig erfasst. Stattdessen ist eine Demontage von Hand notwendig, andernfalls kann es bei der Weiterverarbeitung leicht zu Schäden kommen – etwa durch metallische Kontaminationen wie Klammern, die das Spritzgießwerkzeug beschädigen oder aber auch durch die giftigen Dämpfe, die entstehen können, wenn bestimmte Kunststoffe wie Polyvinylchlorid (PVC) bei höherer Temperatur zusammen mit anderen Kunststoffen verarbeitet werden.
REMOTIVE führt nun erstmals an automobilen Bauteilen einen Vergleich aller drei Recyclingmöglichkeiten durch, um unter anderem deren Effizienz und Effektivität, Umweltbilanz und Kosten gegenüberzustellen. Am IKK stehen mechanische Recyclingmethoden im Mittelpunkt, die im Wesentlichen auf der mehrstufigen Reinigung in einem sogenannten Recycling-Extruder und anschließender Weiterverarbeitung des so entstandenen Granulats für Spritzgießanwendungen basieren. Das Forschungsteam am INSC betrachtet nachhaltige und grüne Ansätze für chemische und lösungsmittelbasierte Verfahren. Das Ziel ist es, die Grenzen, Möglichkeiten und Synergien der Recyclingansätze zu untersuchen und daraus Erkenntnisse für ein funktionales Produktdesign abzuleiten, um in Zukunft ein optimiertes und nachhaltiges Recycling zu ermöglichen.
Weitere Informationen zum IKK gibt es unter https://www.ikk.uni-hannover.de/de/.
Die Volkswagenstiftung fördert REMOTIVE innerhalb des Profilbereichs Gesellschaftliche Transformation. In diesem Bereich geht es um Forschung, die mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung Wissensbestände zu Transformationsprozessen erweitert und kritisch reflektiert.
.
20.02.2024: Ernährungsstudie untersucht schlechten Schlaf
.
Guter Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit, doch viele Menschen leiden unter Schlafstörungen. Diese können langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gewichtszunahme und psychischen Störungen führen. Obwohl verschiedenen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Safran, eine positive Wirkung auf den Schlaf nachgesagt wird, fehlt es an wissenschaftlichen Belegen. Das Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Leibniz Universität Hannover (LUH) unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Hahn nimmt sich dieses Themas an. Im Rahmen einer vierwöchigen deutschlandweiten Studie soll die Wirkung von Safranpräparaten bei schlechtem Schlaf untersucht werden. Teilnehmen können Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die unter Schlafstörungen leiden und bereit sind, vier Wochen lang ein Safranpräparat einzunehmen. Die Schlafqualität wird mit Hilfe einer Sportuhr und von Fragebögen gemessen.
Die Studienteilnehmer werden in drei Gruppen aufgeteilt: Die erste Gruppe erhält das Safranpräparat in niedriger Dosierung, die zweite Gruppe in höherer Dosierung und die dritte Gruppe ein Placebo. Die Teilnehmenden der Kontrollgruppe erhalten am Ende der Studie das Safranpräparat und profitieren somit auch von dessen Wirkung. Die Teilnahme an der gesamten Studie ist bequem von zu Hause aus möglich. Ein Besuch vor Ort ist nicht erforderlich.
An der Studie Interessierte können direkt den Screeningfragebogen ausfüllen (Dauer ca. 10 Minuten), um zu erfahren, ob sie als Teilnehmende geeignet sind: https://survey.uni-hannover.de/423598.
Kontakt für Fragen betreffend der Studie und/oder der Studienteilnahme per E-Mail an schlafstudie@nutrition.uni-hannover.de oder unter Tel. 0177 5617911.
.
11.03.2024: Prof. Dr.-Ing. Monika Steinberg ist neue Dekanin der Fakultät III an der Hochschule Hannover
.
Prof. Dr.-Ing. Monika Steinberg hat zum 1. März das Amt der Dekanin an der Fakultät III – Medien, Information und Design der Hochschule Hannover übernommen. Sie folgt damit auf Prof. Timo Schnitt.
Dr.-Ing. Monika Steinberg ist seit 2013 Professorin für Medieninformatik im Studiengang Informationsmanagement der Hochschule Hannover. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Informatik, Information und Design. Mit Monika Steinberg als Dekanin gewinnt die Fakultät III eine erfahrene Führungskraft: Bereits 2021 übernahm sie in der Fakultät das Amt der Studiendekanin für die Abteilung Information und Kommunikation.
Die knappen Ressourcen sowie die krisendominierten letzten Jahre haben die Fakultät vor große Herausforderungen gestellt. Als Dekanin möchte Monika Steinberg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunftsfähigkeit der Fakultät gestalten: „Über kompetenzorientierte Ansätze in der Lehre können wir Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Synergien in Lehre und Hochschulalltag entdecken, wo wir sie vielleicht nicht vermuten. Mit der Besinnung darauf, was wirklich zählt und fehlt, werden wir nun eine zukunftsfähige Strategie für die Fakultät entwickeln. Studienqualität mit all ihren Facetten, wie Lehrqualität, Ausstattung, Studierendenzufriedenheit, Bindung und Aufenthaltsqualität, hat für uns Priorität. Hier sind wir auf einem guten Weg und werden diesen Kurs beibehalten.“
Monika Steinberg studierte Architektur und promovierte in der Informatik an der Leibniz Universität Hannover. Sie war über 17 Jahre in der freien Wirtschaft tätig und mit Web-, Medien- und Digitalisierungsprojekten betraut. Seit 2006 lehrt sie auf dem Gebiet der angewandten Informatik, digitale Medien, Datenbanken, Informationsmanagement und Webentwicklung. Durch ihr umfangreiches Netzwerk konnte sie bereits mehr als 100 studentische Abschlussarbeiten (Diplom, Bachelor, Master) betreuen - oft in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen und Institutionen wie Volkswagen, RTL, Sennheiser, MHH, TUI oder Continental. Zu ihren aktuellen Forschungs- und Lehrgebieten gehören die Informatik mit dem Schwerpunkt Web-Technologie, Datenmanagement, Digitale Medien und Lernen, insbesondere Informationsdesign und Datenmodellierung.
.
11.03.2024: Neuer Forschungsschwerpunkt Energieforschung an der Leibniz Universität Hannover
.
Wie kann der Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem gelingen? Wie heizen wir in Zukunft, welche Antriebstechnologien benutzen wir zur Fortbewegung, und mit welchen Energieträgern versorgen wir unsere Industrie? Können wir unser Energiesystem dabei stabil und kostengünstig halten, und wie reduzieren wir die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten? An der Leibniz Universität Hannover (LUH) arbeiten und forschen etwa 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Fakultäten hinweg gemeinsam an diesen Themen. Die Energieforschung wird jetzt sechster Forschungsschwerpunkt an der LUH. Er ergänzt die fünf bereits etablierten Forschungsschwerpunkte Biomedizinforschung und –technik, Optische Technologien, Produktionstechnik, Quantenoptik und Gravitationsphysik sowie Wissenschaftsreflexion.
Gegenstand der Arbeiten im neuen Forschungsschwerpunkt sind dabei die Weiterentwicklung von ausgewählten Technologien zur Bereitstellung, Speicherung, zum Transport und zur Nutzung von Energie sowie die Betrachtung von systemischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen mit der Umwelt und der Gesellschaft.
Die LUH verfügt über eine lange Historie im Bereich der Energieforschung, beispielsweise in der Kraftwerkstechnik, der elektrischen Energietechnik sowie in der Wind- und Solarenergie. Diese Kompetenzen wurden in den letzten Jahren durch Neuberufungen gezielt verstärkt. Die LUH hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Forschungskompetenz die Transformation des Energiesystems auf nachhaltige Energieträger zu unterstützen. Bereits 2013 wurde das Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE) gegründet, um die Forschungsaktivitäten in Forschungslinien zu bündeln, ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen sowie Kompetenzpartner für Gesellschaft und Industrie zu sein. „Ich freue mich sehr, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem nun offiziellen neuen Forschungsschwerpunkt an diesen gesellschaftlich hochrelevanten Themen arbeiten. Herausragende Forschung wird hier auf vorbildliche Weise disziplinübergreifend gebündelt“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Volker Epping.
An unterschiedlichen Standorten der LUH laufen viele hochaktuelle Forschungsprojekte. So arbeiten etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Großen Wellenkanal im Forschungszentrum Küste und im Testzentrum Tragstrukturen daran, Offshore-Windenergieanlagen noch standfester zu machen. Nachnutzungsstrategien für alte Windenergieanlagen sind ein weiterer Fokus im Bereich der Windenergieforschung. Schwerpunkte der Solarenergieforschung an der LUH sind die Entwicklung hocheffizienter Solarzellen und die Verringerung von Produktionskosten. In der Luftfahrt von morgen und vielen anderen Bereichen spielt grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger eine entscheidende Rolle. Daran und an weiteren Themen des energieeffizienten und nachhaltigen Fliegens wird an der LUH geforscht. Im Bereich Photovoltaik laufen in Kooperation mit dem Institut für Solarforschung in Hameln (ISFH) Forschungsarbeiten zur Integration von Photovoltaik-Anlagen in Gebäudefassaden, die die Nutzung von Dachflächen ergänzen soll.
Zudem geht es im Forschungsschwerpunkt darum, Energietransport, -wandlung und -speicherung zu erforschen, besonders mit biologischen, chemischen, mechanischen und thermischen Verfahren. Im Forschungsbau Dynamik der Energiewandlung werden Systeme zur Energieerzeugung erprobt, beispielsweise um Schwankungen bei der Wind- und Solarenergie abfedern zu können. Zur Energiewandlung werden Techniken wie Wärmepumpen und Elektrolyseure eingesetzt, auch zur Kopplung von Energiesektoren wie Strom, Gas und Wärme.
All dies ist nur dann erfolgreich, wenn die Wege zur Transformation von allen getragen werden. Dafür werden Aspekte der Akzeptanz erforscht. Beispielsweise wird im Immersive Media Lab die Akustik von Windenergieanlagen reproduziert und simuliert und die Wahrnehmung von Schallimmissionen erforscht. Um den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anzuregen, entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem digitale Planspiele für Bürger-, Verwaltungs-, Politik- und Interessensgruppendialoge.
Weitere Informationen zum Forschungsschwerpunkt unter: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/energieforschung.
Einen anschaulichen Überblick über die Forschungsaktivitäten im Bereich Energieforschung an der LUH bietet dieser Film: https://www.youtube.com/watch?v=4STs0Y4feYk.
Ausführliche Texte zu Projekten im Bereich Energieforschung an der LUH sind in einem Unimagazin zum Thema online nachzulesen: https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/veroeffentlichungen/unimagazin/ausgaben/3-4-2022.
.
11.03.2024: Naturtrübe Apfelsäfte fördern die Darmgesundheit
.
Der Darm ist ein zentrales immunogenes Organ des Menschen und beeinflusst das gesamte Immunsystem des Körpers. Er muss einerseits Nährstoffe aufnehmen, anderseits als Barriere wirken und pathogene Bakterien abwehren. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Darmbarriere. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien zeigt nun, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt.
Eine intakte Darmbarriere ist nicht nur für die Gesundheit des Darms, sondern auch für den gesamten Organismus von zentraler Bedeutung. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sowohl die sportliche Aktivität als auch die Zufuhr von Nahrungsstoffen einen Einfluss auf die Darmbarriere haben. So belegen Studien eine Beeinflussung der Darmbarriere bei extremen körperlichen Belastungen, wie z. B. Marathon und Ultraläufen. Ähnliches wurde bei fettreicher Diät sowie einer fruktosereichen Ernährung festgestellt. Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken nach intensiver körperlicher Belastung ist in einer Vielzahl von Studien als regenerationsfördernd beschrieben worden. Daher wird der Konsum kohlenhydrathaltiger Sportgetränke nach körperlicher Belastung empfohlen. Viele Sportler greifen hier auch zu der natürlichen Alternative in Form von Fruchtsäften oder Fruchtsaftschorlen.
Im Rahmen des Förderprogramms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF, Projekt AIF 21925 N) hat nun eine Arbeitsgruppe der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien gemeinsam untersucht, inwieweit diese Getränke im Zusammenwirken mit körperlicher Belastung die Darmbarriere beeinflussen. Die Ergebnisse wurden kürzlich auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgestellt.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie war, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt, sowohl im Alltag als auch nach körperlicher Belastung. Intensive körperliche Aktivität vermindert die Barrierefunktion im Darm. Hinzu kommt, dass die Aufnahme von Zuckern nach körperlicher Belastung die Regeneration des Darms verlangsamen kann. Werden die Zucker jedoch eingebettet in einer Fruchtsaftmatrix aufgenommen, wie bei naturtrüben Apfelsäften, können diese negativen Effekte deutlich abgemildert werden.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die bereits bekannten positiven Effekte von naturtrüben Apfelsaftschorlen als natürliche Regenerationsgetränke nach körperlicher Belastung. Neben der rehydrierenden Wirkung begünstigen sie auch die Regeneration des Darms nach körperlichen Aktivitäten.
.
04.03.2024: Bessere Rahmenbedingungen für das Jobben von internationalen Studierenden
.
Internationale Studierende stehen in Deutschland vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihres Studiums geht. Sie haben in Deutschland in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie das BAföG, und die Unterhaltszahlungen der Eltern aus dem Heimatland reichen oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zumal die Lebenshaltungskosten in Deutschland in der Regel um ein Vielfaches höher sind als in ihren Herkunftsländern. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sind sie daher oft auf das Jobben angewiesen.
Zum 1. März 2024 wird das jetzt einfacher: durch eine Neuregelung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten: Internationale Studierende dürfen jetzt 140 volle Tage bzw. 280 halbe Tage neben dem Studium jobben. Bislang galt das nur für 120 bzw. 240 halbe Tage.
»Wir wissen, wie wichtig das Jobben für internationale Studierende in Hannover ist«, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. »Deshalb freuen wir uns über diese Neuregelung. Studierende, die Fragen zu den neuen Bestimmungen oder allgemein zur Studienfinanzierung haben, können sich jederzeit an unsere Sozialberatung wenden.«
Die Landeshauptstadt Hannover und das Studentenwerk haben aufgrund der neuen Regelungen auch das Erklär-Video: »Internationale Studierende und Jobben« aktualisiert. Es informiert auf der Mediathek wissen.hannover.de der Initiative Wissenschaft Hannover über die gesetzlichen Regelungen zum Jobben und gibt Tipps zur Jobsuche. Die Aktualisierung des Films stellt sicher, dass internationale Studierende sich stets über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und ihre Jobchancen optimal nutzen können.
Das Video ist eine Koproduktion der Landeshauptstadt Hannover mit dem Studentenwerk Hannover und liegt auf Deutsch und Englisch vor. Erklärvideos sind für Oberbürgermeister Belit Onay ein wichtiger Beitrag zur Willkommenskultur in Hannover: »Internationale Studierende brauchen Service sowie Unterstützung. Sie sind eine Bereicherung für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover und sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele der internationalen Absolvierenden ihren beruflichen Start in Hannover beginnen. Jobben neben dem Studium kann da ein guter Anfang sein. In Zeiten des Fachkräftemangels liegt darin auch eine Chance für die Arbeitgeber*innen in der Region Hannover.«
Zum Video auf www.wissen.hannover.de/jobben.
Kontakt Sozialberatung Studentenwerk Hannover auf https://www.studentenwerk-hannover.de/beratung/sozialberatung.
.
04.03.2024: Licht ins Dunkel der Fotosynthese
.
Für das Leben auf der Erde ist es unerlässlich, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben und mithilfe von Sonnenlicht schließlich Sauerstoff und chemische Energie produzieren. Forschenden aus Göttingen und Hannover gelang nun erstmals, die Kopiermaschine von Chloroplasten, die RNA-Polymerase PEP, hochaufgelöst in 3D sichtbar zu machen. Die detaillierte Struktur bietet neue Einblicke in die Funktion und Evolution dieser komplexen zellulären Maschine, die eine Hauptrolle beim Ablesen der genetischen Bauanleitungen von Fotosynthese-Proteinen spielt.
Ohne Fotosynthese gäbe es keine Luft zum Atmen – sie ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Durch diesen komplexen Prozess können Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Lichtenergie der Sonne in chemische Energie und Sauerstoff umwandeln. Die Umwandlung geschieht in den Chloroplasten, dem Herzstück der Fotosynthese. Chloroplasten entstanden im Laufe der Evolution, als Vorgänger der heutigen Pflanzenzellen ein fotosynthetisches Cyanobakterium in sich aufnahmen. Mit der Zeit wurde das Bakterium immer abhängiger von seiner „Wirtszelle“, behielt aber einige wichtige Funktionen wie die Fotosynthese sowie Teile des bakteriellen Genoms bei. Der Chloroplast besitzt daher noch eigene DNA, in der unter anderem die Baupläne für wichtige Proteine der „Fotosynthese-Maschinerie“ gespeichert sind.
„Eine einzigartige molekulare Kopiermaschine, eine RNA-Polymerase namens PEP, liest die genetischen Anweisungen vom Erbgut der Chloroplasten ab“, erklärt Prof. Dr. Hauke Hillen, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Professor an der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC). Sie sei insbesondere unentbehrlich, um die für die Fotosynthese benötigten Gene zu aktivieren, betont Hillen. Ohne funktionierende PEP können Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und bleiben weiß anstatt grün zu werden.
Nicht nur der Kopiervorgang ist komplex, sondern auch die Kopiermaschine selbst: Sie besteht aus einem mehrteiligen Basis-Komplex, dessen Protein-Untereinheiten im Chloroplasten-Genom kodiert sind, sowie mindestens zwölf angelagerten Proteinen, PAPs genannt. Für diese steuert das Kern-Genom der Pflanzenzelle die Baupläne bei. „Bislang konnten wir zwar ein paar wenige Einzelteile der Chloroplasten-Kopiermaschine strukturell und biochemisch charakterisieren, aber ein präziser Einblick in ihre Gesamtstruktur und die Funktionen der einzelnen PAPs fehlte“, erläutert Prof. Dr. Thomas Pfannschmidt, Professor am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover. In enger Zusammenarbeit gelang es Forschenden um Hauke Hillen und Thomas Pfannschmidt nun erstmals, einen 19-teiligen PEP-Komplex mit einer Auflösung von 3,5 Ångström – 35 Millionen Mal kleiner als ein Millimeter – in 3D sichtbar zu machen.
„Wir haben hierfür intakte PEP aus Weißem Senf, einer typischen Modellpflanze in der Pflanzenforschung, isoliert“, erzählt Frederik Ahrens, Teammitglied in Pfannschmidts Gruppe und einer der Erstautoren der jetzt im Fachjournal Molecular Cell veröffentlichten Studie. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie erstellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ein detailliertes 3D-Modell des 19-teiligen PEP-Komplexes. Dafür wurden die Proben ultraschnell schockgefroren. Tausendfach und bis auf Atomebene fotografierten die Forschenden anschließend die Kopiermaschine aus unterschiedlichsten Winkeln und fügten sie mittels komplizierter Computerberechnungen zu einem Gesamtbild zusammen.
Der strukturelle Schnappschuss zeigte, dass zwar der PEP-Kern denen anderer RNA-Polymerasen, wie etwa in Bakterien oder im Zellkern höherer Zellen, ähnelt. Aber er enthält Chloroplasten-spezifische Merkmale, die die Wechselwirkungen mit den PAPs vermitteln. Letztere finden sich nur in Pflanzen und sie sind in ihrer Struktur einzigartig“, sagt Paula Favoretti Vital do Prado, Doktorandin am MPI, Mitglied des Hertha Sponer College am MBExC und ebenfalls Erstautorin der Studie. Forschende hatten bereits angenommen, dass die PAPs individuelle Funktionen beim Ablesen der Fotosynthese-Gene erfüllen. „Wie wir zeigen konnten, ordnen sich die Proteine in besonderer Weise um den RNA-Polymerase-Kern an. Anhand ihrer Struktur lässt sich vermuten, dass die PAPs auf unterschiedlichste Art mit dem Basis-Komplex wechselwirken und beim Ableseprozess der Gene mitwirken“, ergänzt Hillen.
Die Forschungskollaboration ging mittels Datenbanken auch auf evolutionäre Spurensuche. Sie wollte herausfinden, ob sich die beobachtete Architektur der Kopiermaschine auf andere Pflanzen übertragen lässt. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Struktur des PEP-Komplexes in allen Landpflanzen gleich ist“, so Pfannschmidt. Die neuen Erkenntnisse zum Kopiervorgang der Chloroplasten-DNA tragen dazu bei, grundlegende Mechanismen der Biogenese der Fotosynthese-Maschinerie besser zu verstehen. Sie könnten sich möglicherweise zukünftig auch biotechnologisch nutzen lassen.
.
02.04.2024: Forschungsteam entdeckt Schlüssel-Gen für giftiges Alkaloid in Gerste
.
Gerste ist weltweit eine der wichtigsten Getreidekulturen. Viele Sorten produzieren ein giftiges Alkaloid namens Gramin. Dies schränkt die Nutzung als Futtermittel ein, schützt Gerste aber vor Krankheitserregern und Insekten. Bisher war die genetische Grundlage der Gramin-Biosynthese nicht geklärt, daher konnte die Produktion nicht gesteuert und diese Möglichkeit nicht für die Züchtung genutzt werden. Nun ist es Forschungsgruppen des IPK Leibniz-Instituts und der Leibniz Universität Hannover gelungen, den kompletten Biosyntheseweg von Gramin zu entschlüsseln. Damit wird nicht nur die Produktion in Modellorganismen möglich, sondern kann umgekehrt auch in Gerste unterbunden werden. Die Ergebnisse wurden heute in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Alle Pflanzen vermitteln ihre Interaktionen mit der Umwelt über chemische Signale. Ein Beispiel dafür ist das Alkaloid Gramin, das von Gerste, einer der weltweit am häufigsten angebauten Getreidearten, produziert wird. Gramin bietet Schutz vor pflanzenfressenden Insekten und Weidetieren und hemmt das Wachstum anderer Pflanzen. Trotz langjähriger Forschung war das Schlüsselgen für die Bildung von Gramin aber bislang nicht bekannt.
Die Forscherinnen und Forscher entdeckten in der Gerste nun ein Cluster von zwei Genen für die Gramin-Biosynthese. Das erste Gen (HvNMT) war bereits vor 18 Jahren gefunden worden. In ihrer Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPK und der Leibniz Universität Hannover jetzt ein zweites Schlüsselgen (AMI-Synthase, HvAMIS) für die Biosynthese identifiziert, das auf dem selben Chromosom liegt. Damit ist jetzt der gesamte Stoffwechselweg von Gramin beschrieben.
„Wir haben entdeckt, dass AMIS ein Oxidase-Enzym ist, das eine ungewöhnliche kryptische oxidative Umlagerung von Tryptophan durchführt. Damit können wir die bisherige Theorie zur Gramin-Biosynthese aus den 1960er Jahren revidieren", sagt Dr. John D'Auria, Leiter der IPK-Arbeitsgruppe „Metabolische Diversität“. Prof. Dr. Jakob Franke, Leiter der Arbeitsgruppe „Biochemie sekundärer Pflanzenstoffe“ an der Leibniz Universität Hannover, ergänzt: „Der bisher unbekannte Enzym-Mechanismus, über den Gramin gebildet wird, hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig bietet sich dadurch nun die Möglichkeit, biologisch aktive Alkaloide mit nachhaltigen biotechnologischen Methoden zu produzieren.“
Die Forscherinnen und Forscher konnten damit Gramin in Hefe und Modellpflanzen (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis) herstellen. „Anders als bei vielen anderen pflanzlichen Abwehrstoffen sind zur Bildung von Gramin nur zwei Gene erforderlich. Dadurch lassen sich unsere Erkenntnisse relativ leicht praktisch nutzen“, hebt Ling Chuang von der Leibniz Universität Hannover, eine der Erstautoren, hervor. „Zudem ist es uns durch gentechnische Veränderung auch gelungen, Gramin in einer nicht graminproduzierenden Gerstensorte herzustellen und umgekehrt, die Graminproduktion in einer graminproduzierenden Gerstensorte durch Genom-Editierung zu unterbinden“, sagt Sara Leite Dias, ebenfalls Erstautorin der Studie und von der International Max Planck Research School geförderte Wissenschaftlerin am IPK.
„Die Ergebnisse ermöglichen die Herstellung von Gramin in Organismen, die eigentlich nicht die Fähigkeit haben, es selbst zu synthetisieren“, erklärt John D‘Auria. „Umgekehrt kann Gramin nun aus Gerste und anderen Gräsern eliminiert werden, um die Toxizität für Wiederkäuer zu verringern“, sagt der IPK-Wissenschaftler. „Unter dem Strich bilden die Ergebnisse die Grundlage für die Verbesserung der Gerste, um ihre Resistenz gegen Schädlinge künftig weiter zu erhöhen, ihre Toxizität für Wiederkäuer zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu leisten.“
.
15.04.2024: LUH im Fach Philosophie sehr gut gerankt
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
15.04.2024: Vizepräsidentin verleiht Lehrpreise
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
15.04.2024: Wirtschaft verstehen, Wissen schaffen - Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der LUH wird 50 Jahre alt
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Gourmets schätzen die Spitzen der Pflanze, sie schmecken nach Meer. Doch bislang fristete Queller – auch Meeresspargel genannt – eher ein Nischendasein. Für die industrielle Massenproduktion von Lebensmitteln wird die Pflanze, die auf Salzwiesen oder im Watt wächst, bislang nicht genutzt. Dabei haben Pflanzen wie der Europäische Queller (lat. Salicornia europaea) viele Qualitäten – das ist das Ergebnis des europaweiten Forschungsprojekts Aquacombine, in dem sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr als vier Jahre lang mit dem Potenzial von Halophyten, das heißt von weitgehend salztoleranten Pflanzen, befasst haben. So dient Queller nicht nur als Nahrung, sondern verfügt über wertvolle Polyphenole, kann als Filter in salzhaltigem Wasser eingesetzt werden und trägt darüber hinaus durch sein Wurzelwerk maßgeblich zum Küstenschutz bei.
Die Europäische Union hat das Forschungsvorhaben innerhalb des Programms Horizon 2020 mit zwölf Millionen Euro gefördert. Das Institut für Botanik an der Leibniz Universität Hannover (LUH) war unter Leitung von Prof. Dr. Jutta Papenbrock als einer von 17 Projektpartnern dabei. Die Gesamtleitung lag bei der Aalborg University, Dänemark. Das Ziel: herauszufinden, ob und inwiefern sich die Eigenschaften der Pflanze nutzen lassen, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, und ob es möglich ist, eine Nutzungskette mit hoher Wertschöpfung aufzubauen.
Eine der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist die Deckung des weltweiten Bedarfs an nachhaltig erzeugter Biomasse, sowohl für die Ernährung von Mensch und Tier als auch für den immer wichtiger werdenden Sektor der Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Unmittelbar damit verbunden sind ein steigender Süßwasserbedarf für die Landwirtschaft und der Verlust von Ackerland aufgrund von Versalzung.
Salicornia europaea und verwandte Arten werden in der EU wegen ihrer frischen Spitzen, die als Gemüse gegessen werden, bislang nur in einigen wenigen Regionen in kleinem Maßstab kommerziell angebaut. Sie zählt – genau wie die ebenfalls untersuchten Pflanzenarten Strandaster (Tripolium pannonicum) und Meeresfenchel (Crithmum maritimum) – zu den sogenannten Halophyten, das bedeutet, diese Pflanzen sind tolerant gegenüber Salzwasser. Aufgrund dieser besonderen physiologischen Eigenschaften und biochemischen Zusammensetzung sind Halophyten eine für verschiedene Studien und biologische Anwendungen interessante Pflanzengruppe.
Das Interesse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der LUH galt zunächst dem Potenzial der Pflanzen als Kulturpflanze. Der Vorteil gegenüber nicht salztoleranten Arten liegt dabei auf der Hand: Halophyten brauchen kein Süßwasser und wachsen an Küsten oder in Salzwüsten, also auch dort, wo andere Pflanzen nicht gedeihen. Dabei benötigt die Pflanze wenig Platz. Versuche am Institut für Botanik der LUH mit einer eigens aufgebauten Pilotanlage zeigten, dass die Aufzucht auch in einem Gewächshaus mit Kunstlicht möglich ist und dass sich der Ertrag unter günstigen Bedingungen, wie einer optimalen Salzkonzentration in der Nährlösung, erheblich steigern lässt, was langfristig für die Produktion von Queller in großem Umfang wichtig wäre. Hinzu kommt, dass gerade Salicornia nicht nur schmackhaft ist, sondern auch gesund: Die Pflanze ist reich an Polyphenolen, diese wirken antioxidativ und entzündungshemmend.
Aber Halophyten können noch mehr. Im Institut für Botanik hat Andre Fussy, Doktorand im Team von Prof. Dr. Papenbrock, mithilfe molekularbiologischer Techniken das Geheimnis der außergewöhnlichen Salztoleranz des Europäischen Quellers näher untersucht. Wie so oft liegt die Antwort in den Genen der Pflanze. Einerseits könnten sie es in Zukunft ermöglichen, andere Pflanzen wie Tomaten so zu verändern, dass sie besser mit salzigen Böden zurechtkommen. Andererseits können die Untersuchungen auf molekularer Ebene dazu beitragen, Queller schneller als Nutzpflanze zu etablieren.
Daneben untersuchten andere an Aquacombine beteiligte Partner, ob es machbar ist, die Bewässerung an eine Fischkultur zu koppeln, da die Pflanzen auf diese Weise die Nährstoffe aus der Fischkultur filtern und wiederverwenden können. Auch die Phytoremediation – das heißt ein möglicher Einsatz zur Regeneration salzhaltiger Böden – war Thema des Projekts. Insgesamt hat Aquacombine dazu beigetragen, neue stresstolerante Pflanzen im Sinne der Bioökonomie nutzbar zu machen.
.
.
Haltegriffe, Kofferraumabdeckungen und Mittelkonsolen: Viele Fahrzeugteile sind aus Kunststoff gefertigt. Gegenüber Metall hat dies viele Vorteile – unter anderem ist Kunststoff deutlich leichter, was sich nicht zuletzt auf den Treibstoff- und Energieverbrauch von Autos positiv auswirkt. Die Entsorgung bzw. die Rückführung von Kunststoffen in den Wertstoffkreislauf gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger, nicht zuletzt, weil die einzelnen Fahrzeugteile aus unterschiedlich zusammengesetzten Kunststoffkomponenten bestehen.
Ein neues Forschungsvorhaben am IKK – Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik der Leibniz Universität Hannover (LUH) strebt unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hans-Josef Endres erstmals einen Vergleich der gängigen Recycling-Methoden an. Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „REMOTIVE - Zirkularität mit recycelten und biogenen Rohstoffen“ vier Jahre lang mit insgesamt 1,3 Millionen Euro. Projektpartner sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg, unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Kümmerer.
Aktualität gewinnt das Forschungsvorhaben zudem durch die Pläne der Europäischen Union zu einer Verordnung, die die Verwertung von Altfahrzeugen neu regeln soll. Demnach sollen ab dem Jahr 2030 bei neuen Fahrzeugen mindestens 25 Prozent aller Kunststoffbauteile aus Rezyklat bestehen – davon sollen wiederum mindestens 25 Prozent aus Alt-Fahrzeugen stammen. Künftig bestehen also mehr als sechs Prozent aller Kunststoffbauteile eines Autos aus alten Automobilbauteilen.
Beim Recycling von Kunststoffen gibt es drei übergeordnete Verfahren: die chemischen, die lösungsmittelbasierten und die mechanischen. Allen drei Recyclingmethoden ist gleich, dass die Kunststoffe vorher möglichst sortenrein getrennt werden müssen, um qualitativ hochwertiges Rezyklat zu erhalten. Dies ist vergleichsweise aufwendig, aber notwendig, denn viele Bauteile, wie etwa eine Mittelkonsole, bestehen nicht nur aus unterschiedlichen Kunststoffen, sondern aus vielen verschiedenen Kunststoffkomponenten und zusätzlich noch aus anderen Materialien wie Metall, Faserverbundwerkstoffen oder Klebstoff. Da die Kunststoffe in Fahrzeugen meist schwarz sind, fällt eine Trennung per gängigen spektroskopischen Verfahren aus, denn aufgrund der eingesetzten Farbstoffe werden die Teile nicht richtig erfasst. Stattdessen ist eine Demontage von Hand notwendig, andernfalls kann es bei der Weiterverarbeitung leicht zu Schäden kommen – etwa durch metallische Kontaminationen wie Klammern, die das Spritzgießwerkzeug beschädigen oder aber auch durch die giftigen Dämpfe, die entstehen können, wenn bestimmte Kunststoffe wie Polyvinylchlorid (PVC) bei höherer Temperatur zusammen mit anderen Kunststoffen verarbeitet werden.
REMOTIVE führt nun erstmals an automobilen Bauteilen einen Vergleich aller drei Recyclingmöglichkeiten durch, um unter anderem deren Effizienz und Effektivität, Umweltbilanz und Kosten gegenüberzustellen. Am IKK stehen mechanische Recyclingmethoden im Mittelpunkt, die im Wesentlichen auf der mehrstufigen Reinigung in einem sogenannten Recycling-Extruder und anschließender Weiterverarbeitung des so entstandenen Granulats für Spritzgießanwendungen basieren. Das Forschungsteam am INSC betrachtet nachhaltige und grüne Ansätze für chemische und lösungsmittelbasierte Verfahren. Das Ziel ist es, die Grenzen, Möglichkeiten und Synergien der Recyclingansätze zu untersuchen und daraus Erkenntnisse für ein funktionales Produktdesign abzuleiten, um in Zukunft ein optimiertes und nachhaltiges Recycling zu ermöglichen.
Weitere Informationen zum IKK gibt es unter https://www.ikk.uni-hannover.de/de/.
Die Volkswagenstiftung fördert REMOTIVE innerhalb des Profilbereichs Gesellschaftliche Transformation. In diesem Bereich geht es um Forschung, die mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung Wissensbestände zu Transformationsprozessen erweitert und kritisch reflektiert.
.
Haltegriffe, Kofferraumabdeckungen und Mittelkonsolen: Viele Fahrzeugteile sind aus Kunststoff gefertigt. Gegenüber Metall hat dies viele Vorteile – unter anderem ist Kunststoff deutlich leichter, was sich nicht zuletzt auf den Treibstoff- und Energieverbrauch von Autos positiv auswirkt. Die Entsorgung bzw. die Rückführung von Kunststoffen in den Wertstoffkreislauf gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger, nicht zuletzt, weil die einzelnen Fahrzeugteile aus unterschiedlich zusammengesetzten Kunststoffkomponenten bestehen.
Ein neues Forschungsvorhaben am IKK – Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik der Leibniz Universität Hannover (LUH) strebt unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hans-Josef Endres erstmals einen Vergleich der gängigen Recycling-Methoden an. Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt „REMOTIVE - Zirkularität mit recycelten und biogenen Rohstoffen“ vier Jahre lang mit insgesamt 1,3 Millionen Euro. Projektpartner sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für nachhaltige Chemie (INSC), Leuphana Universität Lüneburg, unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Kümmerer.
Aktualität gewinnt das Forschungsvorhaben zudem durch die Pläne der Europäischen Union zu einer Verordnung, die die Verwertung von Altfahrzeugen neu regeln soll. Demnach sollen ab dem Jahr 2030 bei neuen Fahrzeugen mindestens 25 Prozent aller Kunststoffbauteile aus Rezyklat bestehen – davon sollen wiederum mindestens 25 Prozent aus Alt-Fahrzeugen stammen. Künftig bestehen also mehr als sechs Prozent aller Kunststoffbauteile eines Autos aus alten Automobilbauteilen.
Beim Recycling von Kunststoffen gibt es drei übergeordnete Verfahren: die chemischen, die lösungsmittelbasierten und die mechanischen. Allen drei Recyclingmethoden ist gleich, dass die Kunststoffe vorher möglichst sortenrein getrennt werden müssen, um qualitativ hochwertiges Rezyklat zu erhalten. Dies ist vergleichsweise aufwendig, aber notwendig, denn viele Bauteile, wie etwa eine Mittelkonsole, bestehen nicht nur aus unterschiedlichen Kunststoffen, sondern aus vielen verschiedenen Kunststoffkomponenten und zusätzlich noch aus anderen Materialien wie Metall, Faserverbundwerkstoffen oder Klebstoff. Da die Kunststoffe in Fahrzeugen meist schwarz sind, fällt eine Trennung per gängigen spektroskopischen Verfahren aus, denn aufgrund der eingesetzten Farbstoffe werden die Teile nicht richtig erfasst. Stattdessen ist eine Demontage von Hand notwendig, andernfalls kann es bei der Weiterverarbeitung leicht zu Schäden kommen – etwa durch metallische Kontaminationen wie Klammern, die das Spritzgießwerkzeug beschädigen oder aber auch durch die giftigen Dämpfe, die entstehen können, wenn bestimmte Kunststoffe wie Polyvinylchlorid (PVC) bei höherer Temperatur zusammen mit anderen Kunststoffen verarbeitet werden.
REMOTIVE führt nun erstmals an automobilen Bauteilen einen Vergleich aller drei Recyclingmöglichkeiten durch, um unter anderem deren Effizienz und Effektivität, Umweltbilanz und Kosten gegenüberzustellen. Am IKK stehen mechanische Recyclingmethoden im Mittelpunkt, die im Wesentlichen auf der mehrstufigen Reinigung in einem sogenannten Recycling-Extruder und anschließender Weiterverarbeitung des so entstandenen Granulats für Spritzgießanwendungen basieren. Das Forschungsteam am INSC betrachtet nachhaltige und grüne Ansätze für chemische und lösungsmittelbasierte Verfahren. Das Ziel ist es, die Grenzen, Möglichkeiten und Synergien der Recyclingansätze zu untersuchen und daraus Erkenntnisse für ein funktionales Produktdesign abzuleiten, um in Zukunft ein optimiertes und nachhaltiges Recycling zu ermöglichen.
Weitere Informationen zum IKK gibt es unter https://www.ikk.uni-hannover.de/de/.
Die Volkswagenstiftung fördert REMOTIVE innerhalb des Profilbereichs Gesellschaftliche Transformation. In diesem Bereich geht es um Forschung, die mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung Wissensbestände zu Transformationsprozessen erweitert und kritisch reflektiert.
.
20.02.2024: Ernährungsstudie untersucht schlechten Schlaf
.
Guter Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit, doch viele Menschen leiden unter Schlafstörungen. Diese können langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gewichtszunahme und psychischen Störungen führen. Obwohl verschiedenen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Safran, eine positive Wirkung auf den Schlaf nachgesagt wird, fehlt es an wissenschaftlichen Belegen. Das Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Leibniz Universität Hannover (LUH) unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Hahn nimmt sich dieses Themas an. Im Rahmen einer vierwöchigen deutschlandweiten Studie soll die Wirkung von Safranpräparaten bei schlechtem Schlaf untersucht werden. Teilnehmen können Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die unter Schlafstörungen leiden und bereit sind, vier Wochen lang ein Safranpräparat einzunehmen. Die Schlafqualität wird mit Hilfe einer Sportuhr und von Fragebögen gemessen.
Die Studienteilnehmer werden in drei Gruppen aufgeteilt: Die erste Gruppe erhält das Safranpräparat in niedriger Dosierung, die zweite Gruppe in höherer Dosierung und die dritte Gruppe ein Placebo. Die Teilnehmenden der Kontrollgruppe erhalten am Ende der Studie das Safranpräparat und profitieren somit auch von dessen Wirkung. Die Teilnahme an der gesamten Studie ist bequem von zu Hause aus möglich. Ein Besuch vor Ort ist nicht erforderlich.
An der Studie Interessierte können direkt den Screeningfragebogen ausfüllen (Dauer ca. 10 Minuten), um zu erfahren, ob sie als Teilnehmende geeignet sind: https://survey.uni-hannover.de/423598.
Kontakt für Fragen betreffend der Studie und/oder der Studienteilnahme per E-Mail an schlafstudie@nutrition.uni-hannover.de oder unter Tel. 0177 5617911.
.
11.03.2024: Prof. Dr.-Ing. Monika Steinberg ist neue Dekanin der Fakultät III an der Hochschule Hannover
.
Prof. Dr.-Ing. Monika Steinberg hat zum 1. März das Amt der Dekanin an der Fakultät III – Medien, Information und Design der Hochschule Hannover übernommen. Sie folgt damit auf Prof. Timo Schnitt.
Dr.-Ing. Monika Steinberg ist seit 2013 Professorin für Medieninformatik im Studiengang Informationsmanagement der Hochschule Hannover. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Informatik, Information und Design. Mit Monika Steinberg als Dekanin gewinnt die Fakultät III eine erfahrene Führungskraft: Bereits 2021 übernahm sie in der Fakultät das Amt der Studiendekanin für die Abteilung Information und Kommunikation.
Die knappen Ressourcen sowie die krisendominierten letzten Jahre haben die Fakultät vor große Herausforderungen gestellt. Als Dekanin möchte Monika Steinberg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunftsfähigkeit der Fakultät gestalten: „Über kompetenzorientierte Ansätze in der Lehre können wir Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Synergien in Lehre und Hochschulalltag entdecken, wo wir sie vielleicht nicht vermuten. Mit der Besinnung darauf, was wirklich zählt und fehlt, werden wir nun eine zukunftsfähige Strategie für die Fakultät entwickeln. Studienqualität mit all ihren Facetten, wie Lehrqualität, Ausstattung, Studierendenzufriedenheit, Bindung und Aufenthaltsqualität, hat für uns Priorität. Hier sind wir auf einem guten Weg und werden diesen Kurs beibehalten.“
Monika Steinberg studierte Architektur und promovierte in der Informatik an der Leibniz Universität Hannover. Sie war über 17 Jahre in der freien Wirtschaft tätig und mit Web-, Medien- und Digitalisierungsprojekten betraut. Seit 2006 lehrt sie auf dem Gebiet der angewandten Informatik, digitale Medien, Datenbanken, Informationsmanagement und Webentwicklung. Durch ihr umfangreiches Netzwerk konnte sie bereits mehr als 100 studentische Abschlussarbeiten (Diplom, Bachelor, Master) betreuen - oft in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen und Institutionen wie Volkswagen, RTL, Sennheiser, MHH, TUI oder Continental. Zu ihren aktuellen Forschungs- und Lehrgebieten gehören die Informatik mit dem Schwerpunkt Web-Technologie, Datenmanagement, Digitale Medien und Lernen, insbesondere Informationsdesign und Datenmodellierung.
.
11.03.2024: Neuer Forschungsschwerpunkt Energieforschung an der Leibniz Universität Hannover
.
Wie kann der Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem gelingen? Wie heizen wir in Zukunft, welche Antriebstechnologien benutzen wir zur Fortbewegung, und mit welchen Energieträgern versorgen wir unsere Industrie? Können wir unser Energiesystem dabei stabil und kostengünstig halten, und wie reduzieren wir die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten? An der Leibniz Universität Hannover (LUH) arbeiten und forschen etwa 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Fakultäten hinweg gemeinsam an diesen Themen. Die Energieforschung wird jetzt sechster Forschungsschwerpunkt an der LUH. Er ergänzt die fünf bereits etablierten Forschungsschwerpunkte Biomedizinforschung und –technik, Optische Technologien, Produktionstechnik, Quantenoptik und Gravitationsphysik sowie Wissenschaftsreflexion.
Gegenstand der Arbeiten im neuen Forschungsschwerpunkt sind dabei die Weiterentwicklung von ausgewählten Technologien zur Bereitstellung, Speicherung, zum Transport und zur Nutzung von Energie sowie die Betrachtung von systemischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen mit der Umwelt und der Gesellschaft.
Die LUH verfügt über eine lange Historie im Bereich der Energieforschung, beispielsweise in der Kraftwerkstechnik, der elektrischen Energietechnik sowie in der Wind- und Solarenergie. Diese Kompetenzen wurden in den letzten Jahren durch Neuberufungen gezielt verstärkt. Die LUH hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Forschungskompetenz die Transformation des Energiesystems auf nachhaltige Energieträger zu unterstützen. Bereits 2013 wurde das Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE) gegründet, um die Forschungsaktivitäten in Forschungslinien zu bündeln, ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen sowie Kompetenzpartner für Gesellschaft und Industrie zu sein. „Ich freue mich sehr, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem nun offiziellen neuen Forschungsschwerpunkt an diesen gesellschaftlich hochrelevanten Themen arbeiten. Herausragende Forschung wird hier auf vorbildliche Weise disziplinübergreifend gebündelt“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Volker Epping.
An unterschiedlichen Standorten der LUH laufen viele hochaktuelle Forschungsprojekte. So arbeiten etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Großen Wellenkanal im Forschungszentrum Küste und im Testzentrum Tragstrukturen daran, Offshore-Windenergieanlagen noch standfester zu machen. Nachnutzungsstrategien für alte Windenergieanlagen sind ein weiterer Fokus im Bereich der Windenergieforschung. Schwerpunkte der Solarenergieforschung an der LUH sind die Entwicklung hocheffizienter Solarzellen und die Verringerung von Produktionskosten. In der Luftfahrt von morgen und vielen anderen Bereichen spielt grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger eine entscheidende Rolle. Daran und an weiteren Themen des energieeffizienten und nachhaltigen Fliegens wird an der LUH geforscht. Im Bereich Photovoltaik laufen in Kooperation mit dem Institut für Solarforschung in Hameln (ISFH) Forschungsarbeiten zur Integration von Photovoltaik-Anlagen in Gebäudefassaden, die die Nutzung von Dachflächen ergänzen soll.
Zudem geht es im Forschungsschwerpunkt darum, Energietransport, -wandlung und -speicherung zu erforschen, besonders mit biologischen, chemischen, mechanischen und thermischen Verfahren. Im Forschungsbau Dynamik der Energiewandlung werden Systeme zur Energieerzeugung erprobt, beispielsweise um Schwankungen bei der Wind- und Solarenergie abfedern zu können. Zur Energiewandlung werden Techniken wie Wärmepumpen und Elektrolyseure eingesetzt, auch zur Kopplung von Energiesektoren wie Strom, Gas und Wärme.
All dies ist nur dann erfolgreich, wenn die Wege zur Transformation von allen getragen werden. Dafür werden Aspekte der Akzeptanz erforscht. Beispielsweise wird im Immersive Media Lab die Akustik von Windenergieanlagen reproduziert und simuliert und die Wahrnehmung von Schallimmissionen erforscht. Um den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anzuregen, entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem digitale Planspiele für Bürger-, Verwaltungs-, Politik- und Interessensgruppendialoge.
Weitere Informationen zum Forschungsschwerpunkt unter: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/energieforschung.
Einen anschaulichen Überblick über die Forschungsaktivitäten im Bereich Energieforschung an der LUH bietet dieser Film: https://www.youtube.com/watch?v=4STs0Y4feYk.
Ausführliche Texte zu Projekten im Bereich Energieforschung an der LUH sind in einem Unimagazin zum Thema online nachzulesen: https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/veroeffentlichungen/unimagazin/ausgaben/3-4-2022.
.
11.03.2024: Naturtrübe Apfelsäfte fördern die Darmgesundheit
.
Der Darm ist ein zentrales immunogenes Organ des Menschen und beeinflusst das gesamte Immunsystem des Körpers. Er muss einerseits Nährstoffe aufnehmen, anderseits als Barriere wirken und pathogene Bakterien abwehren. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Darmbarriere. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien zeigt nun, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt.
Eine intakte Darmbarriere ist nicht nur für die Gesundheit des Darms, sondern auch für den gesamten Organismus von zentraler Bedeutung. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sowohl die sportliche Aktivität als auch die Zufuhr von Nahrungsstoffen einen Einfluss auf die Darmbarriere haben. So belegen Studien eine Beeinflussung der Darmbarriere bei extremen körperlichen Belastungen, wie z. B. Marathon und Ultraläufen. Ähnliches wurde bei fettreicher Diät sowie einer fruktosereichen Ernährung festgestellt. Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken nach intensiver körperlicher Belastung ist in einer Vielzahl von Studien als regenerationsfördernd beschrieben worden. Daher wird der Konsum kohlenhydrathaltiger Sportgetränke nach körperlicher Belastung empfohlen. Viele Sportler greifen hier auch zu der natürlichen Alternative in Form von Fruchtsäften oder Fruchtsaftschorlen.
Im Rahmen des Förderprogramms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF, Projekt AIF 21925 N) hat nun eine Arbeitsgruppe der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien gemeinsam untersucht, inwieweit diese Getränke im Zusammenwirken mit körperlicher Belastung die Darmbarriere beeinflussen. Die Ergebnisse wurden kürzlich auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgestellt.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie war, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt, sowohl im Alltag als auch nach körperlicher Belastung. Intensive körperliche Aktivität vermindert die Barrierefunktion im Darm. Hinzu kommt, dass die Aufnahme von Zuckern nach körperlicher Belastung die Regeneration des Darms verlangsamen kann. Werden die Zucker jedoch eingebettet in einer Fruchtsaftmatrix aufgenommen, wie bei naturtrüben Apfelsäften, können diese negativen Effekte deutlich abgemildert werden.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die bereits bekannten positiven Effekte von naturtrüben Apfelsaftschorlen als natürliche Regenerationsgetränke nach körperlicher Belastung. Neben der rehydrierenden Wirkung begünstigen sie auch die Regeneration des Darms nach körperlichen Aktivitäten.
.
04.03.2024: Bessere Rahmenbedingungen für das Jobben von internationalen Studierenden
.
Internationale Studierende stehen in Deutschland vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihres Studiums geht. Sie haben in Deutschland in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie das BAföG, und die Unterhaltszahlungen der Eltern aus dem Heimatland reichen oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zumal die Lebenshaltungskosten in Deutschland in der Regel um ein Vielfaches höher sind als in ihren Herkunftsländern. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sind sie daher oft auf das Jobben angewiesen.
Zum 1. März 2024 wird das jetzt einfacher: durch eine Neuregelung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten: Internationale Studierende dürfen jetzt 140 volle Tage bzw. 280 halbe Tage neben dem Studium jobben. Bislang galt das nur für 120 bzw. 240 halbe Tage.
»Wir wissen, wie wichtig das Jobben für internationale Studierende in Hannover ist«, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. »Deshalb freuen wir uns über diese Neuregelung. Studierende, die Fragen zu den neuen Bestimmungen oder allgemein zur Studienfinanzierung haben, können sich jederzeit an unsere Sozialberatung wenden.«
Die Landeshauptstadt Hannover und das Studentenwerk haben aufgrund der neuen Regelungen auch das Erklär-Video: »Internationale Studierende und Jobben« aktualisiert. Es informiert auf der Mediathek wissen.hannover.de der Initiative Wissenschaft Hannover über die gesetzlichen Regelungen zum Jobben und gibt Tipps zur Jobsuche. Die Aktualisierung des Films stellt sicher, dass internationale Studierende sich stets über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und ihre Jobchancen optimal nutzen können.
Das Video ist eine Koproduktion der Landeshauptstadt Hannover mit dem Studentenwerk Hannover und liegt auf Deutsch und Englisch vor. Erklärvideos sind für Oberbürgermeister Belit Onay ein wichtiger Beitrag zur Willkommenskultur in Hannover: »Internationale Studierende brauchen Service sowie Unterstützung. Sie sind eine Bereicherung für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover und sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele der internationalen Absolvierenden ihren beruflichen Start in Hannover beginnen. Jobben neben dem Studium kann da ein guter Anfang sein. In Zeiten des Fachkräftemangels liegt darin auch eine Chance für die Arbeitgeber*innen in der Region Hannover.«
Zum Video auf www.wissen.hannover.de/jobben.
Kontakt Sozialberatung Studentenwerk Hannover auf https://www.studentenwerk-hannover.de/beratung/sozialberatung.
.
04.03.2024: Licht ins Dunkel der Fotosynthese
.
Für das Leben auf der Erde ist es unerlässlich, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben und mithilfe von Sonnenlicht schließlich Sauerstoff und chemische Energie produzieren. Forschenden aus Göttingen und Hannover gelang nun erstmals, die Kopiermaschine von Chloroplasten, die RNA-Polymerase PEP, hochaufgelöst in 3D sichtbar zu machen. Die detaillierte Struktur bietet neue Einblicke in die Funktion und Evolution dieser komplexen zellulären Maschine, die eine Hauptrolle beim Ablesen der genetischen Bauanleitungen von Fotosynthese-Proteinen spielt.
Ohne Fotosynthese gäbe es keine Luft zum Atmen – sie ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Durch diesen komplexen Prozess können Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Lichtenergie der Sonne in chemische Energie und Sauerstoff umwandeln. Die Umwandlung geschieht in den Chloroplasten, dem Herzstück der Fotosynthese. Chloroplasten entstanden im Laufe der Evolution, als Vorgänger der heutigen Pflanzenzellen ein fotosynthetisches Cyanobakterium in sich aufnahmen. Mit der Zeit wurde das Bakterium immer abhängiger von seiner „Wirtszelle“, behielt aber einige wichtige Funktionen wie die Fotosynthese sowie Teile des bakteriellen Genoms bei. Der Chloroplast besitzt daher noch eigene DNA, in der unter anderem die Baupläne für wichtige Proteine der „Fotosynthese-Maschinerie“ gespeichert sind.
„Eine einzigartige molekulare Kopiermaschine, eine RNA-Polymerase namens PEP, liest die genetischen Anweisungen vom Erbgut der Chloroplasten ab“, erklärt Prof. Dr. Hauke Hillen, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Professor an der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC). Sie sei insbesondere unentbehrlich, um die für die Fotosynthese benötigten Gene zu aktivieren, betont Hillen. Ohne funktionierende PEP können Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und bleiben weiß anstatt grün zu werden.
Nicht nur der Kopiervorgang ist komplex, sondern auch die Kopiermaschine selbst: Sie besteht aus einem mehrteiligen Basis-Komplex, dessen Protein-Untereinheiten im Chloroplasten-Genom kodiert sind, sowie mindestens zwölf angelagerten Proteinen, PAPs genannt. Für diese steuert das Kern-Genom der Pflanzenzelle die Baupläne bei. „Bislang konnten wir zwar ein paar wenige Einzelteile der Chloroplasten-Kopiermaschine strukturell und biochemisch charakterisieren, aber ein präziser Einblick in ihre Gesamtstruktur und die Funktionen der einzelnen PAPs fehlte“, erläutert Prof. Dr. Thomas Pfannschmidt, Professor am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover. In enger Zusammenarbeit gelang es Forschenden um Hauke Hillen und Thomas Pfannschmidt nun erstmals, einen 19-teiligen PEP-Komplex mit einer Auflösung von 3,5 Ångström – 35 Millionen Mal kleiner als ein Millimeter – in 3D sichtbar zu machen.
„Wir haben hierfür intakte PEP aus Weißem Senf, einer typischen Modellpflanze in der Pflanzenforschung, isoliert“, erzählt Frederik Ahrens, Teammitglied in Pfannschmidts Gruppe und einer der Erstautoren der jetzt im Fachjournal Molecular Cell veröffentlichten Studie. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie erstellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ein detailliertes 3D-Modell des 19-teiligen PEP-Komplexes. Dafür wurden die Proben ultraschnell schockgefroren. Tausendfach und bis auf Atomebene fotografierten die Forschenden anschließend die Kopiermaschine aus unterschiedlichsten Winkeln und fügten sie mittels komplizierter Computerberechnungen zu einem Gesamtbild zusammen.
Der strukturelle Schnappschuss zeigte, dass zwar der PEP-Kern denen anderer RNA-Polymerasen, wie etwa in Bakterien oder im Zellkern höherer Zellen, ähnelt. Aber er enthält Chloroplasten-spezifische Merkmale, die die Wechselwirkungen mit den PAPs vermitteln. Letztere finden sich nur in Pflanzen und sie sind in ihrer Struktur einzigartig“, sagt Paula Favoretti Vital do Prado, Doktorandin am MPI, Mitglied des Hertha Sponer College am MBExC und ebenfalls Erstautorin der Studie. Forschende hatten bereits angenommen, dass die PAPs individuelle Funktionen beim Ablesen der Fotosynthese-Gene erfüllen. „Wie wir zeigen konnten, ordnen sich die Proteine in besonderer Weise um den RNA-Polymerase-Kern an. Anhand ihrer Struktur lässt sich vermuten, dass die PAPs auf unterschiedlichste Art mit dem Basis-Komplex wechselwirken und beim Ableseprozess der Gene mitwirken“, ergänzt Hillen.
Die Forschungskollaboration ging mittels Datenbanken auch auf evolutionäre Spurensuche. Sie wollte herausfinden, ob sich die beobachtete Architektur der Kopiermaschine auf andere Pflanzen übertragen lässt. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Struktur des PEP-Komplexes in allen Landpflanzen gleich ist“, so Pfannschmidt. Die neuen Erkenntnisse zum Kopiervorgang der Chloroplasten-DNA tragen dazu bei, grundlegende Mechanismen der Biogenese der Fotosynthese-Maschinerie besser zu verstehen. Sie könnten sich möglicherweise zukünftig auch biotechnologisch nutzen lassen.
.
02.04.2024: Forschungsteam entdeckt Schlüssel-Gen für giftiges Alkaloid in Gerste
.
Gerste ist weltweit eine der wichtigsten Getreidekulturen. Viele Sorten produzieren ein giftiges Alkaloid namens Gramin. Dies schränkt die Nutzung als Futtermittel ein, schützt Gerste aber vor Krankheitserregern und Insekten. Bisher war die genetische Grundlage der Gramin-Biosynthese nicht geklärt, daher konnte die Produktion nicht gesteuert und diese Möglichkeit nicht für die Züchtung genutzt werden. Nun ist es Forschungsgruppen des IPK Leibniz-Instituts und der Leibniz Universität Hannover gelungen, den kompletten Biosyntheseweg von Gramin zu entschlüsseln. Damit wird nicht nur die Produktion in Modellorganismen möglich, sondern kann umgekehrt auch in Gerste unterbunden werden. Die Ergebnisse wurden heute in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Alle Pflanzen vermitteln ihre Interaktionen mit der Umwelt über chemische Signale. Ein Beispiel dafür ist das Alkaloid Gramin, das von Gerste, einer der weltweit am häufigsten angebauten Getreidearten, produziert wird. Gramin bietet Schutz vor pflanzenfressenden Insekten und Weidetieren und hemmt das Wachstum anderer Pflanzen. Trotz langjähriger Forschung war das Schlüsselgen für die Bildung von Gramin aber bislang nicht bekannt.
Die Forscherinnen und Forscher entdeckten in der Gerste nun ein Cluster von zwei Genen für die Gramin-Biosynthese. Das erste Gen (HvNMT) war bereits vor 18 Jahren gefunden worden. In ihrer Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPK und der Leibniz Universität Hannover jetzt ein zweites Schlüsselgen (AMI-Synthase, HvAMIS) für die Biosynthese identifiziert, das auf dem selben Chromosom liegt. Damit ist jetzt der gesamte Stoffwechselweg von Gramin beschrieben.
„Wir haben entdeckt, dass AMIS ein Oxidase-Enzym ist, das eine ungewöhnliche kryptische oxidative Umlagerung von Tryptophan durchführt. Damit können wir die bisherige Theorie zur Gramin-Biosynthese aus den 1960er Jahren revidieren", sagt Dr. John D'Auria, Leiter der IPK-Arbeitsgruppe „Metabolische Diversität“. Prof. Dr. Jakob Franke, Leiter der Arbeitsgruppe „Biochemie sekundärer Pflanzenstoffe“ an der Leibniz Universität Hannover, ergänzt: „Der bisher unbekannte Enzym-Mechanismus, über den Gramin gebildet wird, hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig bietet sich dadurch nun die Möglichkeit, biologisch aktive Alkaloide mit nachhaltigen biotechnologischen Methoden zu produzieren.“
Die Forscherinnen und Forscher konnten damit Gramin in Hefe und Modellpflanzen (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis) herstellen. „Anders als bei vielen anderen pflanzlichen Abwehrstoffen sind zur Bildung von Gramin nur zwei Gene erforderlich. Dadurch lassen sich unsere Erkenntnisse relativ leicht praktisch nutzen“, hebt Ling Chuang von der Leibniz Universität Hannover, eine der Erstautoren, hervor. „Zudem ist es uns durch gentechnische Veränderung auch gelungen, Gramin in einer nicht graminproduzierenden Gerstensorte herzustellen und umgekehrt, die Graminproduktion in einer graminproduzierenden Gerstensorte durch Genom-Editierung zu unterbinden“, sagt Sara Leite Dias, ebenfalls Erstautorin der Studie und von der International Max Planck Research School geförderte Wissenschaftlerin am IPK.
„Die Ergebnisse ermöglichen die Herstellung von Gramin in Organismen, die eigentlich nicht die Fähigkeit haben, es selbst zu synthetisieren“, erklärt John D‘Auria. „Umgekehrt kann Gramin nun aus Gerste und anderen Gräsern eliminiert werden, um die Toxizität für Wiederkäuer zu verringern“, sagt der IPK-Wissenschaftler. „Unter dem Strich bilden die Ergebnisse die Grundlage für die Verbesserung der Gerste, um ihre Resistenz gegen Schädlinge künftig weiter zu erhöhen, ihre Toxizität für Wiederkäuer zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu leisten.“
.
15.04.2024: LUH im Fach Philosophie sehr gut gerankt
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
15.04.2024: Vizepräsidentin verleiht Lehrpreise
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
15.04.2024: Wirtschaft verstehen, Wissen schaffen - Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der LUH wird 50 Jahre alt
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Guter Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit, doch viele Menschen leiden unter Schlafstörungen. Diese können langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gewichtszunahme und psychischen Störungen führen. Obwohl verschiedenen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Safran, eine positive Wirkung auf den Schlaf nachgesagt wird, fehlt es an wissenschaftlichen Belegen. Das Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Leibniz Universität Hannover (LUH) unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Hahn nimmt sich dieses Themas an. Im Rahmen einer vierwöchigen deutschlandweiten Studie soll die Wirkung von Safranpräparaten bei schlechtem Schlaf untersucht werden. Teilnehmen können Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die unter Schlafstörungen leiden und bereit sind, vier Wochen lang ein Safranpräparat einzunehmen. Die Schlafqualität wird mit Hilfe einer Sportuhr und von Fragebögen gemessen.
Die Studienteilnehmer werden in drei Gruppen aufgeteilt: Die erste Gruppe erhält das Safranpräparat in niedriger Dosierung, die zweite Gruppe in höherer Dosierung und die dritte Gruppe ein Placebo. Die Teilnehmenden der Kontrollgruppe erhalten am Ende der Studie das Safranpräparat und profitieren somit auch von dessen Wirkung. Die Teilnahme an der gesamten Studie ist bequem von zu Hause aus möglich. Ein Besuch vor Ort ist nicht erforderlich.
An der Studie Interessierte können direkt den Screeningfragebogen ausfüllen (Dauer ca. 10 Minuten), um zu erfahren, ob sie als Teilnehmende geeignet sind: https://survey.uni-hannover.de/423598.
Kontakt für Fragen betreffend der Studie und/oder der Studienteilnahme per E-Mail an schlafstudie@nutrition.uni-hannover.de oder unter Tel. 0177 5617911.
.
.
Prof. Dr.-Ing. Monika Steinberg hat zum 1. März das Amt der Dekanin an der Fakultät III – Medien, Information und Design der Hochschule Hannover übernommen. Sie folgt damit auf Prof. Timo Schnitt.
Dr.-Ing. Monika Steinberg ist seit 2013 Professorin für Medieninformatik im Studiengang Informationsmanagement der Hochschule Hannover. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Informatik, Information und Design. Mit Monika Steinberg als Dekanin gewinnt die Fakultät III eine erfahrene Führungskraft: Bereits 2021 übernahm sie in der Fakultät das Amt der Studiendekanin für die Abteilung Information und Kommunikation.
Die knappen Ressourcen sowie die krisendominierten letzten Jahre haben die Fakultät vor große Herausforderungen gestellt. Als Dekanin möchte Monika Steinberg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunftsfähigkeit der Fakultät gestalten: „Über kompetenzorientierte Ansätze in der Lehre können wir Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Synergien in Lehre und Hochschulalltag entdecken, wo wir sie vielleicht nicht vermuten. Mit der Besinnung darauf, was wirklich zählt und fehlt, werden wir nun eine zukunftsfähige Strategie für die Fakultät entwickeln. Studienqualität mit all ihren Facetten, wie Lehrqualität, Ausstattung, Studierendenzufriedenheit, Bindung und Aufenthaltsqualität, hat für uns Priorität. Hier sind wir auf einem guten Weg und werden diesen Kurs beibehalten.“
Monika Steinberg studierte Architektur und promovierte in der Informatik an der Leibniz Universität Hannover. Sie war über 17 Jahre in der freien Wirtschaft tätig und mit Web-, Medien- und Digitalisierungsprojekten betraut. Seit 2006 lehrt sie auf dem Gebiet der angewandten Informatik, digitale Medien, Datenbanken, Informationsmanagement und Webentwicklung. Durch ihr umfangreiches Netzwerk konnte sie bereits mehr als 100 studentische Abschlussarbeiten (Diplom, Bachelor, Master) betreuen - oft in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen und Institutionen wie Volkswagen, RTL, Sennheiser, MHH, TUI oder Continental. Zu ihren aktuellen Forschungs- und Lehrgebieten gehören die Informatik mit dem Schwerpunkt Web-Technologie, Datenmanagement, Digitale Medien und Lernen, insbesondere Informationsdesign und Datenmodellierung.
.
Prof. Dr.-Ing. Monika Steinberg hat zum 1. März das Amt der Dekanin an der Fakultät III – Medien, Information und Design der Hochschule Hannover übernommen. Sie folgt damit auf Prof. Timo Schnitt.
Dr.-Ing. Monika Steinberg ist seit 2013 Professorin für Medieninformatik im Studiengang Informationsmanagement der Hochschule Hannover. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Informatik, Information und Design. Mit Monika Steinberg als Dekanin gewinnt die Fakultät III eine erfahrene Führungskraft: Bereits 2021 übernahm sie in der Fakultät das Amt der Studiendekanin für die Abteilung Information und Kommunikation.
Die knappen Ressourcen sowie die krisendominierten letzten Jahre haben die Fakultät vor große Herausforderungen gestellt. Als Dekanin möchte Monika Steinberg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunftsfähigkeit der Fakultät gestalten: „Über kompetenzorientierte Ansätze in der Lehre können wir Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Synergien in Lehre und Hochschulalltag entdecken, wo wir sie vielleicht nicht vermuten. Mit der Besinnung darauf, was wirklich zählt und fehlt, werden wir nun eine zukunftsfähige Strategie für die Fakultät entwickeln. Studienqualität mit all ihren Facetten, wie Lehrqualität, Ausstattung, Studierendenzufriedenheit, Bindung und Aufenthaltsqualität, hat für uns Priorität. Hier sind wir auf einem guten Weg und werden diesen Kurs beibehalten.“
Monika Steinberg studierte Architektur und promovierte in der Informatik an der Leibniz Universität Hannover. Sie war über 17 Jahre in der freien Wirtschaft tätig und mit Web-, Medien- und Digitalisierungsprojekten betraut. Seit 2006 lehrt sie auf dem Gebiet der angewandten Informatik, digitale Medien, Datenbanken, Informationsmanagement und Webentwicklung. Durch ihr umfangreiches Netzwerk konnte sie bereits mehr als 100 studentische Abschlussarbeiten (Diplom, Bachelor, Master) betreuen - oft in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen und Institutionen wie Volkswagen, RTL, Sennheiser, MHH, TUI oder Continental. Zu ihren aktuellen Forschungs- und Lehrgebieten gehören die Informatik mit dem Schwerpunkt Web-Technologie, Datenmanagement, Digitale Medien und Lernen, insbesondere Informationsdesign und Datenmodellierung.
.
11.03.2024: Neuer Forschungsschwerpunkt Energieforschung an der Leibniz Universität Hannover
.
Wie kann der Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem gelingen? Wie heizen wir in Zukunft, welche Antriebstechnologien benutzen wir zur Fortbewegung, und mit welchen Energieträgern versorgen wir unsere Industrie? Können wir unser Energiesystem dabei stabil und kostengünstig halten, und wie reduzieren wir die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten? An der Leibniz Universität Hannover (LUH) arbeiten und forschen etwa 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Fakultäten hinweg gemeinsam an diesen Themen. Die Energieforschung wird jetzt sechster Forschungsschwerpunkt an der LUH. Er ergänzt die fünf bereits etablierten Forschungsschwerpunkte Biomedizinforschung und –technik, Optische Technologien, Produktionstechnik, Quantenoptik und Gravitationsphysik sowie Wissenschaftsreflexion.
Gegenstand der Arbeiten im neuen Forschungsschwerpunkt sind dabei die Weiterentwicklung von ausgewählten Technologien zur Bereitstellung, Speicherung, zum Transport und zur Nutzung von Energie sowie die Betrachtung von systemischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen mit der Umwelt und der Gesellschaft.
Die LUH verfügt über eine lange Historie im Bereich der Energieforschung, beispielsweise in der Kraftwerkstechnik, der elektrischen Energietechnik sowie in der Wind- und Solarenergie. Diese Kompetenzen wurden in den letzten Jahren durch Neuberufungen gezielt verstärkt. Die LUH hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Forschungskompetenz die Transformation des Energiesystems auf nachhaltige Energieträger zu unterstützen. Bereits 2013 wurde das Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE) gegründet, um die Forschungsaktivitäten in Forschungslinien zu bündeln, ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen sowie Kompetenzpartner für Gesellschaft und Industrie zu sein. „Ich freue mich sehr, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem nun offiziellen neuen Forschungsschwerpunkt an diesen gesellschaftlich hochrelevanten Themen arbeiten. Herausragende Forschung wird hier auf vorbildliche Weise disziplinübergreifend gebündelt“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Volker Epping.
An unterschiedlichen Standorten der LUH laufen viele hochaktuelle Forschungsprojekte. So arbeiten etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Großen Wellenkanal im Forschungszentrum Küste und im Testzentrum Tragstrukturen daran, Offshore-Windenergieanlagen noch standfester zu machen. Nachnutzungsstrategien für alte Windenergieanlagen sind ein weiterer Fokus im Bereich der Windenergieforschung. Schwerpunkte der Solarenergieforschung an der LUH sind die Entwicklung hocheffizienter Solarzellen und die Verringerung von Produktionskosten. In der Luftfahrt von morgen und vielen anderen Bereichen spielt grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger eine entscheidende Rolle. Daran und an weiteren Themen des energieeffizienten und nachhaltigen Fliegens wird an der LUH geforscht. Im Bereich Photovoltaik laufen in Kooperation mit dem Institut für Solarforschung in Hameln (ISFH) Forschungsarbeiten zur Integration von Photovoltaik-Anlagen in Gebäudefassaden, die die Nutzung von Dachflächen ergänzen soll.
Zudem geht es im Forschungsschwerpunkt darum, Energietransport, -wandlung und -speicherung zu erforschen, besonders mit biologischen, chemischen, mechanischen und thermischen Verfahren. Im Forschungsbau Dynamik der Energiewandlung werden Systeme zur Energieerzeugung erprobt, beispielsweise um Schwankungen bei der Wind- und Solarenergie abfedern zu können. Zur Energiewandlung werden Techniken wie Wärmepumpen und Elektrolyseure eingesetzt, auch zur Kopplung von Energiesektoren wie Strom, Gas und Wärme.
All dies ist nur dann erfolgreich, wenn die Wege zur Transformation von allen getragen werden. Dafür werden Aspekte der Akzeptanz erforscht. Beispielsweise wird im Immersive Media Lab die Akustik von Windenergieanlagen reproduziert und simuliert und die Wahrnehmung von Schallimmissionen erforscht. Um den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anzuregen, entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem digitale Planspiele für Bürger-, Verwaltungs-, Politik- und Interessensgruppendialoge.
Weitere Informationen zum Forschungsschwerpunkt unter: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/energieforschung.
Einen anschaulichen Überblick über die Forschungsaktivitäten im Bereich Energieforschung an der LUH bietet dieser Film: https://www.youtube.com/watch?v=4STs0Y4feYk.
Ausführliche Texte zu Projekten im Bereich Energieforschung an der LUH sind in einem Unimagazin zum Thema online nachzulesen: https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/veroeffentlichungen/unimagazin/ausgaben/3-4-2022.
.
11.03.2024: Naturtrübe Apfelsäfte fördern die Darmgesundheit
.
Der Darm ist ein zentrales immunogenes Organ des Menschen und beeinflusst das gesamte Immunsystem des Körpers. Er muss einerseits Nährstoffe aufnehmen, anderseits als Barriere wirken und pathogene Bakterien abwehren. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Darmbarriere. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien zeigt nun, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt.
Eine intakte Darmbarriere ist nicht nur für die Gesundheit des Darms, sondern auch für den gesamten Organismus von zentraler Bedeutung. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sowohl die sportliche Aktivität als auch die Zufuhr von Nahrungsstoffen einen Einfluss auf die Darmbarriere haben. So belegen Studien eine Beeinflussung der Darmbarriere bei extremen körperlichen Belastungen, wie z. B. Marathon und Ultraläufen. Ähnliches wurde bei fettreicher Diät sowie einer fruktosereichen Ernährung festgestellt. Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken nach intensiver körperlicher Belastung ist in einer Vielzahl von Studien als regenerationsfördernd beschrieben worden. Daher wird der Konsum kohlenhydrathaltiger Sportgetränke nach körperlicher Belastung empfohlen. Viele Sportler greifen hier auch zu der natürlichen Alternative in Form von Fruchtsäften oder Fruchtsaftschorlen.
Im Rahmen des Förderprogramms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF, Projekt AIF 21925 N) hat nun eine Arbeitsgruppe der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien gemeinsam untersucht, inwieweit diese Getränke im Zusammenwirken mit körperlicher Belastung die Darmbarriere beeinflussen. Die Ergebnisse wurden kürzlich auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgestellt.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie war, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt, sowohl im Alltag als auch nach körperlicher Belastung. Intensive körperliche Aktivität vermindert die Barrierefunktion im Darm. Hinzu kommt, dass die Aufnahme von Zuckern nach körperlicher Belastung die Regeneration des Darms verlangsamen kann. Werden die Zucker jedoch eingebettet in einer Fruchtsaftmatrix aufgenommen, wie bei naturtrüben Apfelsäften, können diese negativen Effekte deutlich abgemildert werden.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die bereits bekannten positiven Effekte von naturtrüben Apfelsaftschorlen als natürliche Regenerationsgetränke nach körperlicher Belastung. Neben der rehydrierenden Wirkung begünstigen sie auch die Regeneration des Darms nach körperlichen Aktivitäten.
.
04.03.2024: Bessere Rahmenbedingungen für das Jobben von internationalen Studierenden
.
Internationale Studierende stehen in Deutschland vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihres Studiums geht. Sie haben in Deutschland in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie das BAföG, und die Unterhaltszahlungen der Eltern aus dem Heimatland reichen oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zumal die Lebenshaltungskosten in Deutschland in der Regel um ein Vielfaches höher sind als in ihren Herkunftsländern. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sind sie daher oft auf das Jobben angewiesen.
Zum 1. März 2024 wird das jetzt einfacher: durch eine Neuregelung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten: Internationale Studierende dürfen jetzt 140 volle Tage bzw. 280 halbe Tage neben dem Studium jobben. Bislang galt das nur für 120 bzw. 240 halbe Tage.
»Wir wissen, wie wichtig das Jobben für internationale Studierende in Hannover ist«, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. »Deshalb freuen wir uns über diese Neuregelung. Studierende, die Fragen zu den neuen Bestimmungen oder allgemein zur Studienfinanzierung haben, können sich jederzeit an unsere Sozialberatung wenden.«
Die Landeshauptstadt Hannover und das Studentenwerk haben aufgrund der neuen Regelungen auch das Erklär-Video: »Internationale Studierende und Jobben« aktualisiert. Es informiert auf der Mediathek wissen.hannover.de der Initiative Wissenschaft Hannover über die gesetzlichen Regelungen zum Jobben und gibt Tipps zur Jobsuche. Die Aktualisierung des Films stellt sicher, dass internationale Studierende sich stets über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und ihre Jobchancen optimal nutzen können.
Das Video ist eine Koproduktion der Landeshauptstadt Hannover mit dem Studentenwerk Hannover und liegt auf Deutsch und Englisch vor. Erklärvideos sind für Oberbürgermeister Belit Onay ein wichtiger Beitrag zur Willkommenskultur in Hannover: »Internationale Studierende brauchen Service sowie Unterstützung. Sie sind eine Bereicherung für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover und sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele der internationalen Absolvierenden ihren beruflichen Start in Hannover beginnen. Jobben neben dem Studium kann da ein guter Anfang sein. In Zeiten des Fachkräftemangels liegt darin auch eine Chance für die Arbeitgeber*innen in der Region Hannover.«
Zum Video auf www.wissen.hannover.de/jobben.
Kontakt Sozialberatung Studentenwerk Hannover auf https://www.studentenwerk-hannover.de/beratung/sozialberatung.
.
04.03.2024: Licht ins Dunkel der Fotosynthese
.
Für das Leben auf der Erde ist es unerlässlich, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben und mithilfe von Sonnenlicht schließlich Sauerstoff und chemische Energie produzieren. Forschenden aus Göttingen und Hannover gelang nun erstmals, die Kopiermaschine von Chloroplasten, die RNA-Polymerase PEP, hochaufgelöst in 3D sichtbar zu machen. Die detaillierte Struktur bietet neue Einblicke in die Funktion und Evolution dieser komplexen zellulären Maschine, die eine Hauptrolle beim Ablesen der genetischen Bauanleitungen von Fotosynthese-Proteinen spielt.
Ohne Fotosynthese gäbe es keine Luft zum Atmen – sie ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Durch diesen komplexen Prozess können Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Lichtenergie der Sonne in chemische Energie und Sauerstoff umwandeln. Die Umwandlung geschieht in den Chloroplasten, dem Herzstück der Fotosynthese. Chloroplasten entstanden im Laufe der Evolution, als Vorgänger der heutigen Pflanzenzellen ein fotosynthetisches Cyanobakterium in sich aufnahmen. Mit der Zeit wurde das Bakterium immer abhängiger von seiner „Wirtszelle“, behielt aber einige wichtige Funktionen wie die Fotosynthese sowie Teile des bakteriellen Genoms bei. Der Chloroplast besitzt daher noch eigene DNA, in der unter anderem die Baupläne für wichtige Proteine der „Fotosynthese-Maschinerie“ gespeichert sind.
„Eine einzigartige molekulare Kopiermaschine, eine RNA-Polymerase namens PEP, liest die genetischen Anweisungen vom Erbgut der Chloroplasten ab“, erklärt Prof. Dr. Hauke Hillen, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Professor an der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC). Sie sei insbesondere unentbehrlich, um die für die Fotosynthese benötigten Gene zu aktivieren, betont Hillen. Ohne funktionierende PEP können Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und bleiben weiß anstatt grün zu werden.
Nicht nur der Kopiervorgang ist komplex, sondern auch die Kopiermaschine selbst: Sie besteht aus einem mehrteiligen Basis-Komplex, dessen Protein-Untereinheiten im Chloroplasten-Genom kodiert sind, sowie mindestens zwölf angelagerten Proteinen, PAPs genannt. Für diese steuert das Kern-Genom der Pflanzenzelle die Baupläne bei. „Bislang konnten wir zwar ein paar wenige Einzelteile der Chloroplasten-Kopiermaschine strukturell und biochemisch charakterisieren, aber ein präziser Einblick in ihre Gesamtstruktur und die Funktionen der einzelnen PAPs fehlte“, erläutert Prof. Dr. Thomas Pfannschmidt, Professor am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover. In enger Zusammenarbeit gelang es Forschenden um Hauke Hillen und Thomas Pfannschmidt nun erstmals, einen 19-teiligen PEP-Komplex mit einer Auflösung von 3,5 Ångström – 35 Millionen Mal kleiner als ein Millimeter – in 3D sichtbar zu machen.
„Wir haben hierfür intakte PEP aus Weißem Senf, einer typischen Modellpflanze in der Pflanzenforschung, isoliert“, erzählt Frederik Ahrens, Teammitglied in Pfannschmidts Gruppe und einer der Erstautoren der jetzt im Fachjournal Molecular Cell veröffentlichten Studie. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie erstellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ein detailliertes 3D-Modell des 19-teiligen PEP-Komplexes. Dafür wurden die Proben ultraschnell schockgefroren. Tausendfach und bis auf Atomebene fotografierten die Forschenden anschließend die Kopiermaschine aus unterschiedlichsten Winkeln und fügten sie mittels komplizierter Computerberechnungen zu einem Gesamtbild zusammen.
Der strukturelle Schnappschuss zeigte, dass zwar der PEP-Kern denen anderer RNA-Polymerasen, wie etwa in Bakterien oder im Zellkern höherer Zellen, ähnelt. Aber er enthält Chloroplasten-spezifische Merkmale, die die Wechselwirkungen mit den PAPs vermitteln. Letztere finden sich nur in Pflanzen und sie sind in ihrer Struktur einzigartig“, sagt Paula Favoretti Vital do Prado, Doktorandin am MPI, Mitglied des Hertha Sponer College am MBExC und ebenfalls Erstautorin der Studie. Forschende hatten bereits angenommen, dass die PAPs individuelle Funktionen beim Ablesen der Fotosynthese-Gene erfüllen. „Wie wir zeigen konnten, ordnen sich die Proteine in besonderer Weise um den RNA-Polymerase-Kern an. Anhand ihrer Struktur lässt sich vermuten, dass die PAPs auf unterschiedlichste Art mit dem Basis-Komplex wechselwirken und beim Ableseprozess der Gene mitwirken“, ergänzt Hillen.
Die Forschungskollaboration ging mittels Datenbanken auch auf evolutionäre Spurensuche. Sie wollte herausfinden, ob sich die beobachtete Architektur der Kopiermaschine auf andere Pflanzen übertragen lässt. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Struktur des PEP-Komplexes in allen Landpflanzen gleich ist“, so Pfannschmidt. Die neuen Erkenntnisse zum Kopiervorgang der Chloroplasten-DNA tragen dazu bei, grundlegende Mechanismen der Biogenese der Fotosynthese-Maschinerie besser zu verstehen. Sie könnten sich möglicherweise zukünftig auch biotechnologisch nutzen lassen.
.
02.04.2024: Forschungsteam entdeckt Schlüssel-Gen für giftiges Alkaloid in Gerste
.
Gerste ist weltweit eine der wichtigsten Getreidekulturen. Viele Sorten produzieren ein giftiges Alkaloid namens Gramin. Dies schränkt die Nutzung als Futtermittel ein, schützt Gerste aber vor Krankheitserregern und Insekten. Bisher war die genetische Grundlage der Gramin-Biosynthese nicht geklärt, daher konnte die Produktion nicht gesteuert und diese Möglichkeit nicht für die Züchtung genutzt werden. Nun ist es Forschungsgruppen des IPK Leibniz-Instituts und der Leibniz Universität Hannover gelungen, den kompletten Biosyntheseweg von Gramin zu entschlüsseln. Damit wird nicht nur die Produktion in Modellorganismen möglich, sondern kann umgekehrt auch in Gerste unterbunden werden. Die Ergebnisse wurden heute in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Alle Pflanzen vermitteln ihre Interaktionen mit der Umwelt über chemische Signale. Ein Beispiel dafür ist das Alkaloid Gramin, das von Gerste, einer der weltweit am häufigsten angebauten Getreidearten, produziert wird. Gramin bietet Schutz vor pflanzenfressenden Insekten und Weidetieren und hemmt das Wachstum anderer Pflanzen. Trotz langjähriger Forschung war das Schlüsselgen für die Bildung von Gramin aber bislang nicht bekannt.
Die Forscherinnen und Forscher entdeckten in der Gerste nun ein Cluster von zwei Genen für die Gramin-Biosynthese. Das erste Gen (HvNMT) war bereits vor 18 Jahren gefunden worden. In ihrer Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPK und der Leibniz Universität Hannover jetzt ein zweites Schlüsselgen (AMI-Synthase, HvAMIS) für die Biosynthese identifiziert, das auf dem selben Chromosom liegt. Damit ist jetzt der gesamte Stoffwechselweg von Gramin beschrieben.
„Wir haben entdeckt, dass AMIS ein Oxidase-Enzym ist, das eine ungewöhnliche kryptische oxidative Umlagerung von Tryptophan durchführt. Damit können wir die bisherige Theorie zur Gramin-Biosynthese aus den 1960er Jahren revidieren", sagt Dr. John D'Auria, Leiter der IPK-Arbeitsgruppe „Metabolische Diversität“. Prof. Dr. Jakob Franke, Leiter der Arbeitsgruppe „Biochemie sekundärer Pflanzenstoffe“ an der Leibniz Universität Hannover, ergänzt: „Der bisher unbekannte Enzym-Mechanismus, über den Gramin gebildet wird, hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig bietet sich dadurch nun die Möglichkeit, biologisch aktive Alkaloide mit nachhaltigen biotechnologischen Methoden zu produzieren.“
Die Forscherinnen und Forscher konnten damit Gramin in Hefe und Modellpflanzen (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis) herstellen. „Anders als bei vielen anderen pflanzlichen Abwehrstoffen sind zur Bildung von Gramin nur zwei Gene erforderlich. Dadurch lassen sich unsere Erkenntnisse relativ leicht praktisch nutzen“, hebt Ling Chuang von der Leibniz Universität Hannover, eine der Erstautoren, hervor. „Zudem ist es uns durch gentechnische Veränderung auch gelungen, Gramin in einer nicht graminproduzierenden Gerstensorte herzustellen und umgekehrt, die Graminproduktion in einer graminproduzierenden Gerstensorte durch Genom-Editierung zu unterbinden“, sagt Sara Leite Dias, ebenfalls Erstautorin der Studie und von der International Max Planck Research School geförderte Wissenschaftlerin am IPK.
„Die Ergebnisse ermöglichen die Herstellung von Gramin in Organismen, die eigentlich nicht die Fähigkeit haben, es selbst zu synthetisieren“, erklärt John D‘Auria. „Umgekehrt kann Gramin nun aus Gerste und anderen Gräsern eliminiert werden, um die Toxizität für Wiederkäuer zu verringern“, sagt der IPK-Wissenschaftler. „Unter dem Strich bilden die Ergebnisse die Grundlage für die Verbesserung der Gerste, um ihre Resistenz gegen Schädlinge künftig weiter zu erhöhen, ihre Toxizität für Wiederkäuer zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu leisten.“
.
15.04.2024: LUH im Fach Philosophie sehr gut gerankt
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
15.04.2024: Vizepräsidentin verleiht Lehrpreise
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
15.04.2024: Wirtschaft verstehen, Wissen schaffen - Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der LUH wird 50 Jahre alt
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Wie kann der Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem gelingen? Wie heizen wir in Zukunft, welche Antriebstechnologien benutzen wir zur Fortbewegung, und mit welchen Energieträgern versorgen wir unsere Industrie? Können wir unser Energiesystem dabei stabil und kostengünstig halten, und wie reduzieren wir die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten? An der Leibniz Universität Hannover (LUH) arbeiten und forschen etwa 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Fakultäten hinweg gemeinsam an diesen Themen. Die Energieforschung wird jetzt sechster Forschungsschwerpunkt an der LUH. Er ergänzt die fünf bereits etablierten Forschungsschwerpunkte Biomedizinforschung und –technik, Optische Technologien, Produktionstechnik, Quantenoptik und Gravitationsphysik sowie Wissenschaftsreflexion.
Gegenstand der Arbeiten im neuen Forschungsschwerpunkt sind dabei die Weiterentwicklung von ausgewählten Technologien zur Bereitstellung, Speicherung, zum Transport und zur Nutzung von Energie sowie die Betrachtung von systemischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen mit der Umwelt und der Gesellschaft.
Die LUH verfügt über eine lange Historie im Bereich der Energieforschung, beispielsweise in der Kraftwerkstechnik, der elektrischen Energietechnik sowie in der Wind- und Solarenergie. Diese Kompetenzen wurden in den letzten Jahren durch Neuberufungen gezielt verstärkt. Die LUH hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Forschungskompetenz die Transformation des Energiesystems auf nachhaltige Energieträger zu unterstützen. Bereits 2013 wurde das Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE) gegründet, um die Forschungsaktivitäten in Forschungslinien zu bündeln, ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen sowie Kompetenzpartner für Gesellschaft und Industrie zu sein. „Ich freue mich sehr, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem nun offiziellen neuen Forschungsschwerpunkt an diesen gesellschaftlich hochrelevanten Themen arbeiten. Herausragende Forschung wird hier auf vorbildliche Weise disziplinübergreifend gebündelt“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Volker Epping.
An unterschiedlichen Standorten der LUH laufen viele hochaktuelle Forschungsprojekte. So arbeiten etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Großen Wellenkanal im Forschungszentrum Küste und im Testzentrum Tragstrukturen daran, Offshore-Windenergieanlagen noch standfester zu machen. Nachnutzungsstrategien für alte Windenergieanlagen sind ein weiterer Fokus im Bereich der Windenergieforschung. Schwerpunkte der Solarenergieforschung an der LUH sind die Entwicklung hocheffizienter Solarzellen und die Verringerung von Produktionskosten. In der Luftfahrt von morgen und vielen anderen Bereichen spielt grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger eine entscheidende Rolle. Daran und an weiteren Themen des energieeffizienten und nachhaltigen Fliegens wird an der LUH geforscht. Im Bereich Photovoltaik laufen in Kooperation mit dem Institut für Solarforschung in Hameln (ISFH) Forschungsarbeiten zur Integration von Photovoltaik-Anlagen in Gebäudefassaden, die die Nutzung von Dachflächen ergänzen soll.
Zudem geht es im Forschungsschwerpunkt darum, Energietransport, -wandlung und -speicherung zu erforschen, besonders mit biologischen, chemischen, mechanischen und thermischen Verfahren. Im Forschungsbau Dynamik der Energiewandlung werden Systeme zur Energieerzeugung erprobt, beispielsweise um Schwankungen bei der Wind- und Solarenergie abfedern zu können. Zur Energiewandlung werden Techniken wie Wärmepumpen und Elektrolyseure eingesetzt, auch zur Kopplung von Energiesektoren wie Strom, Gas und Wärme.
All dies ist nur dann erfolgreich, wenn die Wege zur Transformation von allen getragen werden. Dafür werden Aspekte der Akzeptanz erforscht. Beispielsweise wird im Immersive Media Lab die Akustik von Windenergieanlagen reproduziert und simuliert und die Wahrnehmung von Schallimmissionen erforscht. Um den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anzuregen, entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem digitale Planspiele für Bürger-, Verwaltungs-, Politik- und Interessensgruppendialoge.
Weitere Informationen zum Forschungsschwerpunkt unter: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/energieforschung.
Einen anschaulichen Überblick über die Forschungsaktivitäten im Bereich Energieforschung an der LUH bietet dieser Film: https://www.youtube.com/watch?v=4STs0Y4feYk.
Ausführliche Texte zu Projekten im Bereich Energieforschung an der LUH sind in einem Unimagazin zum Thema online nachzulesen: https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/veroeffentlichungen/unimagazin/ausgaben/3-4-2022.
.
.
Der Darm ist ein zentrales immunogenes Organ des Menschen und beeinflusst das gesamte Immunsystem des Körpers. Er muss einerseits Nährstoffe aufnehmen, anderseits als Barriere wirken und pathogene Bakterien abwehren. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Darmbarriere. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien zeigt nun, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt.
Eine intakte Darmbarriere ist nicht nur für die Gesundheit des Darms, sondern auch für den gesamten Organismus von zentraler Bedeutung. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sowohl die sportliche Aktivität als auch die Zufuhr von Nahrungsstoffen einen Einfluss auf die Darmbarriere haben. So belegen Studien eine Beeinflussung der Darmbarriere bei extremen körperlichen Belastungen, wie z. B. Marathon und Ultraläufen. Ähnliches wurde bei fettreicher Diät sowie einer fruktosereichen Ernährung festgestellt. Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken nach intensiver körperlicher Belastung ist in einer Vielzahl von Studien als regenerationsfördernd beschrieben worden. Daher wird der Konsum kohlenhydrathaltiger Sportgetränke nach körperlicher Belastung empfohlen. Viele Sportler greifen hier auch zu der natürlichen Alternative in Form von Fruchtsäften oder Fruchtsaftschorlen.
Im Rahmen des Förderprogramms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF, Projekt AIF 21925 N) hat nun eine Arbeitsgruppe der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien gemeinsam untersucht, inwieweit diese Getränke im Zusammenwirken mit körperlicher Belastung die Darmbarriere beeinflussen. Die Ergebnisse wurden kürzlich auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgestellt.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie war, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt, sowohl im Alltag als auch nach körperlicher Belastung. Intensive körperliche Aktivität vermindert die Barrierefunktion im Darm. Hinzu kommt, dass die Aufnahme von Zuckern nach körperlicher Belastung die Regeneration des Darms verlangsamen kann. Werden die Zucker jedoch eingebettet in einer Fruchtsaftmatrix aufgenommen, wie bei naturtrüben Apfelsäften, können diese negativen Effekte deutlich abgemildert werden.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die bereits bekannten positiven Effekte von naturtrüben Apfelsaftschorlen als natürliche Regenerationsgetränke nach körperlicher Belastung. Neben der rehydrierenden Wirkung begünstigen sie auch die Regeneration des Darms nach körperlichen Aktivitäten.
.
Der Darm ist ein zentrales immunogenes Organ des Menschen und beeinflusst das gesamte Immunsystem des Körpers. Er muss einerseits Nährstoffe aufnehmen, anderseits als Barriere wirken und pathogene Bakterien abwehren. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Darmbarriere. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien zeigt nun, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt.
Eine intakte Darmbarriere ist nicht nur für die Gesundheit des Darms, sondern auch für den gesamten Organismus von zentraler Bedeutung. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sowohl die sportliche Aktivität als auch die Zufuhr von Nahrungsstoffen einen Einfluss auf die Darmbarriere haben. So belegen Studien eine Beeinflussung der Darmbarriere bei extremen körperlichen Belastungen, wie z. B. Marathon und Ultraläufen. Ähnliches wurde bei fettreicher Diät sowie einer fruktosereichen Ernährung festgestellt. Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken nach intensiver körperlicher Belastung ist in einer Vielzahl von Studien als regenerationsfördernd beschrieben worden. Daher wird der Konsum kohlenhydrathaltiger Sportgetränke nach körperlicher Belastung empfohlen. Viele Sportler greifen hier auch zu der natürlichen Alternative in Form von Fruchtsäften oder Fruchtsaftschorlen.
Im Rahmen des Förderprogramms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF, Projekt AIF 21925 N) hat nun eine Arbeitsgruppe der Deutschen Sporthochschule Köln, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Wien gemeinsam untersucht, inwieweit diese Getränke im Zusammenwirken mit körperlicher Belastung die Darmbarriere beeinflussen. Die Ergebnisse wurden kürzlich auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgestellt.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie war, dass sich das Trinken von naturtrüben Apfelsaftschorlen positiv auf die Funktion der Darmbarriere auswirkt, sowohl im Alltag als auch nach körperlicher Belastung. Intensive körperliche Aktivität vermindert die Barrierefunktion im Darm. Hinzu kommt, dass die Aufnahme von Zuckern nach körperlicher Belastung die Regeneration des Darms verlangsamen kann. Werden die Zucker jedoch eingebettet in einer Fruchtsaftmatrix aufgenommen, wie bei naturtrüben Apfelsäften, können diese negativen Effekte deutlich abgemildert werden.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die bereits bekannten positiven Effekte von naturtrüben Apfelsaftschorlen als natürliche Regenerationsgetränke nach körperlicher Belastung. Neben der rehydrierenden Wirkung begünstigen sie auch die Regeneration des Darms nach körperlichen Aktivitäten.
.
04.03.2024: Bessere Rahmenbedingungen für das Jobben von internationalen Studierenden
.
Internationale Studierende stehen in Deutschland vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihres Studiums geht. Sie haben in Deutschland in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie das BAföG, und die Unterhaltszahlungen der Eltern aus dem Heimatland reichen oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zumal die Lebenshaltungskosten in Deutschland in der Regel um ein Vielfaches höher sind als in ihren Herkunftsländern. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sind sie daher oft auf das Jobben angewiesen.
Zum 1. März 2024 wird das jetzt einfacher: durch eine Neuregelung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten: Internationale Studierende dürfen jetzt 140 volle Tage bzw. 280 halbe Tage neben dem Studium jobben. Bislang galt das nur für 120 bzw. 240 halbe Tage.
»Wir wissen, wie wichtig das Jobben für internationale Studierende in Hannover ist«, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. »Deshalb freuen wir uns über diese Neuregelung. Studierende, die Fragen zu den neuen Bestimmungen oder allgemein zur Studienfinanzierung haben, können sich jederzeit an unsere Sozialberatung wenden.«
Die Landeshauptstadt Hannover und das Studentenwerk haben aufgrund der neuen Regelungen auch das Erklär-Video: »Internationale Studierende und Jobben« aktualisiert. Es informiert auf der Mediathek wissen.hannover.de der Initiative Wissenschaft Hannover über die gesetzlichen Regelungen zum Jobben und gibt Tipps zur Jobsuche. Die Aktualisierung des Films stellt sicher, dass internationale Studierende sich stets über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und ihre Jobchancen optimal nutzen können.
Das Video ist eine Koproduktion der Landeshauptstadt Hannover mit dem Studentenwerk Hannover und liegt auf Deutsch und Englisch vor. Erklärvideos sind für Oberbürgermeister Belit Onay ein wichtiger Beitrag zur Willkommenskultur in Hannover: »Internationale Studierende brauchen Service sowie Unterstützung. Sie sind eine Bereicherung für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover und sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele der internationalen Absolvierenden ihren beruflichen Start in Hannover beginnen. Jobben neben dem Studium kann da ein guter Anfang sein. In Zeiten des Fachkräftemangels liegt darin auch eine Chance für die Arbeitgeber*innen in der Region Hannover.«
Zum Video auf www.wissen.hannover.de/jobben.
Kontakt Sozialberatung Studentenwerk Hannover auf https://www.studentenwerk-hannover.de/beratung/sozialberatung.
.
04.03.2024: Licht ins Dunkel der Fotosynthese
.
Für das Leben auf der Erde ist es unerlässlich, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben und mithilfe von Sonnenlicht schließlich Sauerstoff und chemische Energie produzieren. Forschenden aus Göttingen und Hannover gelang nun erstmals, die Kopiermaschine von Chloroplasten, die RNA-Polymerase PEP, hochaufgelöst in 3D sichtbar zu machen. Die detaillierte Struktur bietet neue Einblicke in die Funktion und Evolution dieser komplexen zellulären Maschine, die eine Hauptrolle beim Ablesen der genetischen Bauanleitungen von Fotosynthese-Proteinen spielt.
Ohne Fotosynthese gäbe es keine Luft zum Atmen – sie ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Durch diesen komplexen Prozess können Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Lichtenergie der Sonne in chemische Energie und Sauerstoff umwandeln. Die Umwandlung geschieht in den Chloroplasten, dem Herzstück der Fotosynthese. Chloroplasten entstanden im Laufe der Evolution, als Vorgänger der heutigen Pflanzenzellen ein fotosynthetisches Cyanobakterium in sich aufnahmen. Mit der Zeit wurde das Bakterium immer abhängiger von seiner „Wirtszelle“, behielt aber einige wichtige Funktionen wie die Fotosynthese sowie Teile des bakteriellen Genoms bei. Der Chloroplast besitzt daher noch eigene DNA, in der unter anderem die Baupläne für wichtige Proteine der „Fotosynthese-Maschinerie“ gespeichert sind.
„Eine einzigartige molekulare Kopiermaschine, eine RNA-Polymerase namens PEP, liest die genetischen Anweisungen vom Erbgut der Chloroplasten ab“, erklärt Prof. Dr. Hauke Hillen, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Professor an der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC). Sie sei insbesondere unentbehrlich, um die für die Fotosynthese benötigten Gene zu aktivieren, betont Hillen. Ohne funktionierende PEP können Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und bleiben weiß anstatt grün zu werden.
Nicht nur der Kopiervorgang ist komplex, sondern auch die Kopiermaschine selbst: Sie besteht aus einem mehrteiligen Basis-Komplex, dessen Protein-Untereinheiten im Chloroplasten-Genom kodiert sind, sowie mindestens zwölf angelagerten Proteinen, PAPs genannt. Für diese steuert das Kern-Genom der Pflanzenzelle die Baupläne bei. „Bislang konnten wir zwar ein paar wenige Einzelteile der Chloroplasten-Kopiermaschine strukturell und biochemisch charakterisieren, aber ein präziser Einblick in ihre Gesamtstruktur und die Funktionen der einzelnen PAPs fehlte“, erläutert Prof. Dr. Thomas Pfannschmidt, Professor am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover. In enger Zusammenarbeit gelang es Forschenden um Hauke Hillen und Thomas Pfannschmidt nun erstmals, einen 19-teiligen PEP-Komplex mit einer Auflösung von 3,5 Ångström – 35 Millionen Mal kleiner als ein Millimeter – in 3D sichtbar zu machen.
„Wir haben hierfür intakte PEP aus Weißem Senf, einer typischen Modellpflanze in der Pflanzenforschung, isoliert“, erzählt Frederik Ahrens, Teammitglied in Pfannschmidts Gruppe und einer der Erstautoren der jetzt im Fachjournal Molecular Cell veröffentlichten Studie. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie erstellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ein detailliertes 3D-Modell des 19-teiligen PEP-Komplexes. Dafür wurden die Proben ultraschnell schockgefroren. Tausendfach und bis auf Atomebene fotografierten die Forschenden anschließend die Kopiermaschine aus unterschiedlichsten Winkeln und fügten sie mittels komplizierter Computerberechnungen zu einem Gesamtbild zusammen.
Der strukturelle Schnappschuss zeigte, dass zwar der PEP-Kern denen anderer RNA-Polymerasen, wie etwa in Bakterien oder im Zellkern höherer Zellen, ähnelt. Aber er enthält Chloroplasten-spezifische Merkmale, die die Wechselwirkungen mit den PAPs vermitteln. Letztere finden sich nur in Pflanzen und sie sind in ihrer Struktur einzigartig“, sagt Paula Favoretti Vital do Prado, Doktorandin am MPI, Mitglied des Hertha Sponer College am MBExC und ebenfalls Erstautorin der Studie. Forschende hatten bereits angenommen, dass die PAPs individuelle Funktionen beim Ablesen der Fotosynthese-Gene erfüllen. „Wie wir zeigen konnten, ordnen sich die Proteine in besonderer Weise um den RNA-Polymerase-Kern an. Anhand ihrer Struktur lässt sich vermuten, dass die PAPs auf unterschiedlichste Art mit dem Basis-Komplex wechselwirken und beim Ableseprozess der Gene mitwirken“, ergänzt Hillen.
Die Forschungskollaboration ging mittels Datenbanken auch auf evolutionäre Spurensuche. Sie wollte herausfinden, ob sich die beobachtete Architektur der Kopiermaschine auf andere Pflanzen übertragen lässt. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Struktur des PEP-Komplexes in allen Landpflanzen gleich ist“, so Pfannschmidt. Die neuen Erkenntnisse zum Kopiervorgang der Chloroplasten-DNA tragen dazu bei, grundlegende Mechanismen der Biogenese der Fotosynthese-Maschinerie besser zu verstehen. Sie könnten sich möglicherweise zukünftig auch biotechnologisch nutzen lassen.
.
02.04.2024: Forschungsteam entdeckt Schlüssel-Gen für giftiges Alkaloid in Gerste
.
Gerste ist weltweit eine der wichtigsten Getreidekulturen. Viele Sorten produzieren ein giftiges Alkaloid namens Gramin. Dies schränkt die Nutzung als Futtermittel ein, schützt Gerste aber vor Krankheitserregern und Insekten. Bisher war die genetische Grundlage der Gramin-Biosynthese nicht geklärt, daher konnte die Produktion nicht gesteuert und diese Möglichkeit nicht für die Züchtung genutzt werden. Nun ist es Forschungsgruppen des IPK Leibniz-Instituts und der Leibniz Universität Hannover gelungen, den kompletten Biosyntheseweg von Gramin zu entschlüsseln. Damit wird nicht nur die Produktion in Modellorganismen möglich, sondern kann umgekehrt auch in Gerste unterbunden werden. Die Ergebnisse wurden heute in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Alle Pflanzen vermitteln ihre Interaktionen mit der Umwelt über chemische Signale. Ein Beispiel dafür ist das Alkaloid Gramin, das von Gerste, einer der weltweit am häufigsten angebauten Getreidearten, produziert wird. Gramin bietet Schutz vor pflanzenfressenden Insekten und Weidetieren und hemmt das Wachstum anderer Pflanzen. Trotz langjähriger Forschung war das Schlüsselgen für die Bildung von Gramin aber bislang nicht bekannt.
Die Forscherinnen und Forscher entdeckten in der Gerste nun ein Cluster von zwei Genen für die Gramin-Biosynthese. Das erste Gen (HvNMT) war bereits vor 18 Jahren gefunden worden. In ihrer Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPK und der Leibniz Universität Hannover jetzt ein zweites Schlüsselgen (AMI-Synthase, HvAMIS) für die Biosynthese identifiziert, das auf dem selben Chromosom liegt. Damit ist jetzt der gesamte Stoffwechselweg von Gramin beschrieben.
„Wir haben entdeckt, dass AMIS ein Oxidase-Enzym ist, das eine ungewöhnliche kryptische oxidative Umlagerung von Tryptophan durchführt. Damit können wir die bisherige Theorie zur Gramin-Biosynthese aus den 1960er Jahren revidieren", sagt Dr. John D'Auria, Leiter der IPK-Arbeitsgruppe „Metabolische Diversität“. Prof. Dr. Jakob Franke, Leiter der Arbeitsgruppe „Biochemie sekundärer Pflanzenstoffe“ an der Leibniz Universität Hannover, ergänzt: „Der bisher unbekannte Enzym-Mechanismus, über den Gramin gebildet wird, hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig bietet sich dadurch nun die Möglichkeit, biologisch aktive Alkaloide mit nachhaltigen biotechnologischen Methoden zu produzieren.“
Die Forscherinnen und Forscher konnten damit Gramin in Hefe und Modellpflanzen (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis) herstellen. „Anders als bei vielen anderen pflanzlichen Abwehrstoffen sind zur Bildung von Gramin nur zwei Gene erforderlich. Dadurch lassen sich unsere Erkenntnisse relativ leicht praktisch nutzen“, hebt Ling Chuang von der Leibniz Universität Hannover, eine der Erstautoren, hervor. „Zudem ist es uns durch gentechnische Veränderung auch gelungen, Gramin in einer nicht graminproduzierenden Gerstensorte herzustellen und umgekehrt, die Graminproduktion in einer graminproduzierenden Gerstensorte durch Genom-Editierung zu unterbinden“, sagt Sara Leite Dias, ebenfalls Erstautorin der Studie und von der International Max Planck Research School geförderte Wissenschaftlerin am IPK.
„Die Ergebnisse ermöglichen die Herstellung von Gramin in Organismen, die eigentlich nicht die Fähigkeit haben, es selbst zu synthetisieren“, erklärt John D‘Auria. „Umgekehrt kann Gramin nun aus Gerste und anderen Gräsern eliminiert werden, um die Toxizität für Wiederkäuer zu verringern“, sagt der IPK-Wissenschaftler. „Unter dem Strich bilden die Ergebnisse die Grundlage für die Verbesserung der Gerste, um ihre Resistenz gegen Schädlinge künftig weiter zu erhöhen, ihre Toxizität für Wiederkäuer zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu leisten.“
.
15.04.2024: LUH im Fach Philosophie sehr gut gerankt
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
15.04.2024: Vizepräsidentin verleiht Lehrpreise
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
15.04.2024: Wirtschaft verstehen, Wissen schaffen - Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der LUH wird 50 Jahre alt
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Internationale Studierende stehen in Deutschland vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Finanzierung ihres Studiums geht. Sie haben in Deutschland in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie das BAföG, und die Unterhaltszahlungen der Eltern aus dem Heimatland reichen oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zumal die Lebenshaltungskosten in Deutschland in der Regel um ein Vielfaches höher sind als in ihren Herkunftsländern. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sind sie daher oft auf das Jobben angewiesen.
Zum 1. März 2024 wird das jetzt einfacher: durch eine Neuregelung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten: Internationale Studierende dürfen jetzt 140 volle Tage bzw. 280 halbe Tage neben dem Studium jobben. Bislang galt das nur für 120 bzw. 240 halbe Tage.
»Wir wissen, wie wichtig das Jobben für internationale Studierende in Hannover ist«, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. »Deshalb freuen wir uns über diese Neuregelung. Studierende, die Fragen zu den neuen Bestimmungen oder allgemein zur Studienfinanzierung haben, können sich jederzeit an unsere Sozialberatung wenden.«
Die Landeshauptstadt Hannover und das Studentenwerk haben aufgrund der neuen Regelungen auch das Erklär-Video: »Internationale Studierende und Jobben« aktualisiert. Es informiert auf der Mediathek wissen.hannover.de der Initiative Wissenschaft Hannover über die gesetzlichen Regelungen zum Jobben und gibt Tipps zur Jobsuche. Die Aktualisierung des Films stellt sicher, dass internationale Studierende sich stets über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und ihre Jobchancen optimal nutzen können.
Das Video ist eine Koproduktion der Landeshauptstadt Hannover mit dem Studentenwerk Hannover und liegt auf Deutsch und Englisch vor. Erklärvideos sind für Oberbürgermeister Belit Onay ein wichtiger Beitrag zur Willkommenskultur in Hannover: »Internationale Studierende brauchen Service sowie Unterstützung. Sie sind eine Bereicherung für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Hannover und sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele der internationalen Absolvierenden ihren beruflichen Start in Hannover beginnen. Jobben neben dem Studium kann da ein guter Anfang sein. In Zeiten des Fachkräftemangels liegt darin auch eine Chance für die Arbeitgeber*innen in der Region Hannover.«
Zum Video auf www.wissen.hannover.de/jobben.
Kontakt Sozialberatung Studentenwerk Hannover auf https://www.studentenwerk-hannover.de/beratung/sozialberatung.
.
.
Für das Leben auf der Erde ist es unerlässlich, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben und mithilfe von Sonnenlicht schließlich Sauerstoff und chemische Energie produzieren. Forschenden aus Göttingen und Hannover gelang nun erstmals, die Kopiermaschine von Chloroplasten, die RNA-Polymerase PEP, hochaufgelöst in 3D sichtbar zu machen. Die detaillierte Struktur bietet neue Einblicke in die Funktion und Evolution dieser komplexen zellulären Maschine, die eine Hauptrolle beim Ablesen der genetischen Bauanleitungen von Fotosynthese-Proteinen spielt.
Ohne Fotosynthese gäbe es keine Luft zum Atmen – sie ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Durch diesen komplexen Prozess können Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Lichtenergie der Sonne in chemische Energie und Sauerstoff umwandeln. Die Umwandlung geschieht in den Chloroplasten, dem Herzstück der Fotosynthese. Chloroplasten entstanden im Laufe der Evolution, als Vorgänger der heutigen Pflanzenzellen ein fotosynthetisches Cyanobakterium in sich aufnahmen. Mit der Zeit wurde das Bakterium immer abhängiger von seiner „Wirtszelle“, behielt aber einige wichtige Funktionen wie die Fotosynthese sowie Teile des bakteriellen Genoms bei. Der Chloroplast besitzt daher noch eigene DNA, in der unter anderem die Baupläne für wichtige Proteine der „Fotosynthese-Maschinerie“ gespeichert sind.
„Eine einzigartige molekulare Kopiermaschine, eine RNA-Polymerase namens PEP, liest die genetischen Anweisungen vom Erbgut der Chloroplasten ab“, erklärt Prof. Dr. Hauke Hillen, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Professor an der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC). Sie sei insbesondere unentbehrlich, um die für die Fotosynthese benötigten Gene zu aktivieren, betont Hillen. Ohne funktionierende PEP können Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und bleiben weiß anstatt grün zu werden.
Nicht nur der Kopiervorgang ist komplex, sondern auch die Kopiermaschine selbst: Sie besteht aus einem mehrteiligen Basis-Komplex, dessen Protein-Untereinheiten im Chloroplasten-Genom kodiert sind, sowie mindestens zwölf angelagerten Proteinen, PAPs genannt. Für diese steuert das Kern-Genom der Pflanzenzelle die Baupläne bei. „Bislang konnten wir zwar ein paar wenige Einzelteile der Chloroplasten-Kopiermaschine strukturell und biochemisch charakterisieren, aber ein präziser Einblick in ihre Gesamtstruktur und die Funktionen der einzelnen PAPs fehlte“, erläutert Prof. Dr. Thomas Pfannschmidt, Professor am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover. In enger Zusammenarbeit gelang es Forschenden um Hauke Hillen und Thomas Pfannschmidt nun erstmals, einen 19-teiligen PEP-Komplex mit einer Auflösung von 3,5 Ångström – 35 Millionen Mal kleiner als ein Millimeter – in 3D sichtbar zu machen.
„Wir haben hierfür intakte PEP aus Weißem Senf, einer typischen Modellpflanze in der Pflanzenforschung, isoliert“, erzählt Frederik Ahrens, Teammitglied in Pfannschmidts Gruppe und einer der Erstautoren der jetzt im Fachjournal Molecular Cell veröffentlichten Studie. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie erstellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ein detailliertes 3D-Modell des 19-teiligen PEP-Komplexes. Dafür wurden die Proben ultraschnell schockgefroren. Tausendfach und bis auf Atomebene fotografierten die Forschenden anschließend die Kopiermaschine aus unterschiedlichsten Winkeln und fügten sie mittels komplizierter Computerberechnungen zu einem Gesamtbild zusammen.
Der strukturelle Schnappschuss zeigte, dass zwar der PEP-Kern denen anderer RNA-Polymerasen, wie etwa in Bakterien oder im Zellkern höherer Zellen, ähnelt. Aber er enthält Chloroplasten-spezifische Merkmale, die die Wechselwirkungen mit den PAPs vermitteln. Letztere finden sich nur in Pflanzen und sie sind in ihrer Struktur einzigartig“, sagt Paula Favoretti Vital do Prado, Doktorandin am MPI, Mitglied des Hertha Sponer College am MBExC und ebenfalls Erstautorin der Studie. Forschende hatten bereits angenommen, dass die PAPs individuelle Funktionen beim Ablesen der Fotosynthese-Gene erfüllen. „Wie wir zeigen konnten, ordnen sich die Proteine in besonderer Weise um den RNA-Polymerase-Kern an. Anhand ihrer Struktur lässt sich vermuten, dass die PAPs auf unterschiedlichste Art mit dem Basis-Komplex wechselwirken und beim Ableseprozess der Gene mitwirken“, ergänzt Hillen.
Die Forschungskollaboration ging mittels Datenbanken auch auf evolutionäre Spurensuche. Sie wollte herausfinden, ob sich die beobachtete Architektur der Kopiermaschine auf andere Pflanzen übertragen lässt. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Struktur des PEP-Komplexes in allen Landpflanzen gleich ist“, so Pfannschmidt. Die neuen Erkenntnisse zum Kopiervorgang der Chloroplasten-DNA tragen dazu bei, grundlegende Mechanismen der Biogenese der Fotosynthese-Maschinerie besser zu verstehen. Sie könnten sich möglicherweise zukünftig auch biotechnologisch nutzen lassen.
.
Für das Leben auf der Erde ist es unerlässlich, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben und mithilfe von Sonnenlicht schließlich Sauerstoff und chemische Energie produzieren. Forschenden aus Göttingen und Hannover gelang nun erstmals, die Kopiermaschine von Chloroplasten, die RNA-Polymerase PEP, hochaufgelöst in 3D sichtbar zu machen. Die detaillierte Struktur bietet neue Einblicke in die Funktion und Evolution dieser komplexen zellulären Maschine, die eine Hauptrolle beim Ablesen der genetischen Bauanleitungen von Fotosynthese-Proteinen spielt.
Ohne Fotosynthese gäbe es keine Luft zum Atmen – sie ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Durch diesen komplexen Prozess können Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Lichtenergie der Sonne in chemische Energie und Sauerstoff umwandeln. Die Umwandlung geschieht in den Chloroplasten, dem Herzstück der Fotosynthese. Chloroplasten entstanden im Laufe der Evolution, als Vorgänger der heutigen Pflanzenzellen ein fotosynthetisches Cyanobakterium in sich aufnahmen. Mit der Zeit wurde das Bakterium immer abhängiger von seiner „Wirtszelle“, behielt aber einige wichtige Funktionen wie die Fotosynthese sowie Teile des bakteriellen Genoms bei. Der Chloroplast besitzt daher noch eigene DNA, in der unter anderem die Baupläne für wichtige Proteine der „Fotosynthese-Maschinerie“ gespeichert sind.
„Eine einzigartige molekulare Kopiermaschine, eine RNA-Polymerase namens PEP, liest die genetischen Anweisungen vom Erbgut der Chloroplasten ab“, erklärt Prof. Dr. Hauke Hillen, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Professor an der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (MBExC). Sie sei insbesondere unentbehrlich, um die für die Fotosynthese benötigten Gene zu aktivieren, betont Hillen. Ohne funktionierende PEP können Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und bleiben weiß anstatt grün zu werden.
Nicht nur der Kopiervorgang ist komplex, sondern auch die Kopiermaschine selbst: Sie besteht aus einem mehrteiligen Basis-Komplex, dessen Protein-Untereinheiten im Chloroplasten-Genom kodiert sind, sowie mindestens zwölf angelagerten Proteinen, PAPs genannt. Für diese steuert das Kern-Genom der Pflanzenzelle die Baupläne bei. „Bislang konnten wir zwar ein paar wenige Einzelteile der Chloroplasten-Kopiermaschine strukturell und biochemisch charakterisieren, aber ein präziser Einblick in ihre Gesamtstruktur und die Funktionen der einzelnen PAPs fehlte“, erläutert Prof. Dr. Thomas Pfannschmidt, Professor am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover. In enger Zusammenarbeit gelang es Forschenden um Hauke Hillen und Thomas Pfannschmidt nun erstmals, einen 19-teiligen PEP-Komplex mit einer Auflösung von 3,5 Ångström – 35 Millionen Mal kleiner als ein Millimeter – in 3D sichtbar zu machen.
„Wir haben hierfür intakte PEP aus Weißem Senf, einer typischen Modellpflanze in der Pflanzenforschung, isoliert“, erzählt Frederik Ahrens, Teammitglied in Pfannschmidts Gruppe und einer der Erstautoren der jetzt im Fachjournal Molecular Cell veröffentlichten Studie. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie erstellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ein detailliertes 3D-Modell des 19-teiligen PEP-Komplexes. Dafür wurden die Proben ultraschnell schockgefroren. Tausendfach und bis auf Atomebene fotografierten die Forschenden anschließend die Kopiermaschine aus unterschiedlichsten Winkeln und fügten sie mittels komplizierter Computerberechnungen zu einem Gesamtbild zusammen.
Der strukturelle Schnappschuss zeigte, dass zwar der PEP-Kern denen anderer RNA-Polymerasen, wie etwa in Bakterien oder im Zellkern höherer Zellen, ähnelt. Aber er enthält Chloroplasten-spezifische Merkmale, die die Wechselwirkungen mit den PAPs vermitteln. Letztere finden sich nur in Pflanzen und sie sind in ihrer Struktur einzigartig“, sagt Paula Favoretti Vital do Prado, Doktorandin am MPI, Mitglied des Hertha Sponer College am MBExC und ebenfalls Erstautorin der Studie. Forschende hatten bereits angenommen, dass die PAPs individuelle Funktionen beim Ablesen der Fotosynthese-Gene erfüllen. „Wie wir zeigen konnten, ordnen sich die Proteine in besonderer Weise um den RNA-Polymerase-Kern an. Anhand ihrer Struktur lässt sich vermuten, dass die PAPs auf unterschiedlichste Art mit dem Basis-Komplex wechselwirken und beim Ableseprozess der Gene mitwirken“, ergänzt Hillen.
Die Forschungskollaboration ging mittels Datenbanken auch auf evolutionäre Spurensuche. Sie wollte herausfinden, ob sich die beobachtete Architektur der Kopiermaschine auf andere Pflanzen übertragen lässt. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Struktur des PEP-Komplexes in allen Landpflanzen gleich ist“, so Pfannschmidt. Die neuen Erkenntnisse zum Kopiervorgang der Chloroplasten-DNA tragen dazu bei, grundlegende Mechanismen der Biogenese der Fotosynthese-Maschinerie besser zu verstehen. Sie könnten sich möglicherweise zukünftig auch biotechnologisch nutzen lassen.
.
02.04.2024: Forschungsteam entdeckt Schlüssel-Gen für giftiges Alkaloid in Gerste
.
Gerste ist weltweit eine der wichtigsten Getreidekulturen. Viele Sorten produzieren ein giftiges Alkaloid namens Gramin. Dies schränkt die Nutzung als Futtermittel ein, schützt Gerste aber vor Krankheitserregern und Insekten. Bisher war die genetische Grundlage der Gramin-Biosynthese nicht geklärt, daher konnte die Produktion nicht gesteuert und diese Möglichkeit nicht für die Züchtung genutzt werden. Nun ist es Forschungsgruppen des IPK Leibniz-Instituts und der Leibniz Universität Hannover gelungen, den kompletten Biosyntheseweg von Gramin zu entschlüsseln. Damit wird nicht nur die Produktion in Modellorganismen möglich, sondern kann umgekehrt auch in Gerste unterbunden werden. Die Ergebnisse wurden heute in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Alle Pflanzen vermitteln ihre Interaktionen mit der Umwelt über chemische Signale. Ein Beispiel dafür ist das Alkaloid Gramin, das von Gerste, einer der weltweit am häufigsten angebauten Getreidearten, produziert wird. Gramin bietet Schutz vor pflanzenfressenden Insekten und Weidetieren und hemmt das Wachstum anderer Pflanzen. Trotz langjähriger Forschung war das Schlüsselgen für die Bildung von Gramin aber bislang nicht bekannt.
Die Forscherinnen und Forscher entdeckten in der Gerste nun ein Cluster von zwei Genen für die Gramin-Biosynthese. Das erste Gen (HvNMT) war bereits vor 18 Jahren gefunden worden. In ihrer Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPK und der Leibniz Universität Hannover jetzt ein zweites Schlüsselgen (AMI-Synthase, HvAMIS) für die Biosynthese identifiziert, das auf dem selben Chromosom liegt. Damit ist jetzt der gesamte Stoffwechselweg von Gramin beschrieben.
„Wir haben entdeckt, dass AMIS ein Oxidase-Enzym ist, das eine ungewöhnliche kryptische oxidative Umlagerung von Tryptophan durchführt. Damit können wir die bisherige Theorie zur Gramin-Biosynthese aus den 1960er Jahren revidieren", sagt Dr. John D'Auria, Leiter der IPK-Arbeitsgruppe „Metabolische Diversität“. Prof. Dr. Jakob Franke, Leiter der Arbeitsgruppe „Biochemie sekundärer Pflanzenstoffe“ an der Leibniz Universität Hannover, ergänzt: „Der bisher unbekannte Enzym-Mechanismus, über den Gramin gebildet wird, hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig bietet sich dadurch nun die Möglichkeit, biologisch aktive Alkaloide mit nachhaltigen biotechnologischen Methoden zu produzieren.“
Die Forscherinnen und Forscher konnten damit Gramin in Hefe und Modellpflanzen (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis) herstellen. „Anders als bei vielen anderen pflanzlichen Abwehrstoffen sind zur Bildung von Gramin nur zwei Gene erforderlich. Dadurch lassen sich unsere Erkenntnisse relativ leicht praktisch nutzen“, hebt Ling Chuang von der Leibniz Universität Hannover, eine der Erstautoren, hervor. „Zudem ist es uns durch gentechnische Veränderung auch gelungen, Gramin in einer nicht graminproduzierenden Gerstensorte herzustellen und umgekehrt, die Graminproduktion in einer graminproduzierenden Gerstensorte durch Genom-Editierung zu unterbinden“, sagt Sara Leite Dias, ebenfalls Erstautorin der Studie und von der International Max Planck Research School geförderte Wissenschaftlerin am IPK.
„Die Ergebnisse ermöglichen die Herstellung von Gramin in Organismen, die eigentlich nicht die Fähigkeit haben, es selbst zu synthetisieren“, erklärt John D‘Auria. „Umgekehrt kann Gramin nun aus Gerste und anderen Gräsern eliminiert werden, um die Toxizität für Wiederkäuer zu verringern“, sagt der IPK-Wissenschaftler. „Unter dem Strich bilden die Ergebnisse die Grundlage für die Verbesserung der Gerste, um ihre Resistenz gegen Schädlinge künftig weiter zu erhöhen, ihre Toxizität für Wiederkäuer zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu leisten.“
.
15.04.2024: LUH im Fach Philosophie sehr gut gerankt
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
15.04.2024: Vizepräsidentin verleiht Lehrpreise
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
15.04.2024: Wirtschaft verstehen, Wissen schaffen - Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der LUH wird 50 Jahre alt
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Gerste ist weltweit eine der wichtigsten Getreidekulturen. Viele Sorten produzieren ein giftiges Alkaloid namens Gramin. Dies schränkt die Nutzung als Futtermittel ein, schützt Gerste aber vor Krankheitserregern und Insekten. Bisher war die genetische Grundlage der Gramin-Biosynthese nicht geklärt, daher konnte die Produktion nicht gesteuert und diese Möglichkeit nicht für die Züchtung genutzt werden. Nun ist es Forschungsgruppen des IPK Leibniz-Instituts und der Leibniz Universität Hannover gelungen, den kompletten Biosyntheseweg von Gramin zu entschlüsseln. Damit wird nicht nur die Produktion in Modellorganismen möglich, sondern kann umgekehrt auch in Gerste unterbunden werden. Die Ergebnisse wurden heute in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Alle Pflanzen vermitteln ihre Interaktionen mit der Umwelt über chemische Signale. Ein Beispiel dafür ist das Alkaloid Gramin, das von Gerste, einer der weltweit am häufigsten angebauten Getreidearten, produziert wird. Gramin bietet Schutz vor pflanzenfressenden Insekten und Weidetieren und hemmt das Wachstum anderer Pflanzen. Trotz langjähriger Forschung war das Schlüsselgen für die Bildung von Gramin aber bislang nicht bekannt.
Die Forscherinnen und Forscher entdeckten in der Gerste nun ein Cluster von zwei Genen für die Gramin-Biosynthese. Das erste Gen (HvNMT) war bereits vor 18 Jahren gefunden worden. In ihrer Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPK und der Leibniz Universität Hannover jetzt ein zweites Schlüsselgen (AMI-Synthase, HvAMIS) für die Biosynthese identifiziert, das auf dem selben Chromosom liegt. Damit ist jetzt der gesamte Stoffwechselweg von Gramin beschrieben.
„Wir haben entdeckt, dass AMIS ein Oxidase-Enzym ist, das eine ungewöhnliche kryptische oxidative Umlagerung von Tryptophan durchführt. Damit können wir die bisherige Theorie zur Gramin-Biosynthese aus den 1960er Jahren revidieren", sagt Dr. John D'Auria, Leiter der IPK-Arbeitsgruppe „Metabolische Diversität“. Prof. Dr. Jakob Franke, Leiter der Arbeitsgruppe „Biochemie sekundärer Pflanzenstoffe“ an der Leibniz Universität Hannover, ergänzt: „Der bisher unbekannte Enzym-Mechanismus, über den Gramin gebildet wird, hat uns sehr überrascht. Gleichzeitig bietet sich dadurch nun die Möglichkeit, biologisch aktive Alkaloide mit nachhaltigen biotechnologischen Methoden zu produzieren.“
Die Forscherinnen und Forscher konnten damit Gramin in Hefe und Modellpflanzen (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis) herstellen. „Anders als bei vielen anderen pflanzlichen Abwehrstoffen sind zur Bildung von Gramin nur zwei Gene erforderlich. Dadurch lassen sich unsere Erkenntnisse relativ leicht praktisch nutzen“, hebt Ling Chuang von der Leibniz Universität Hannover, eine der Erstautoren, hervor. „Zudem ist es uns durch gentechnische Veränderung auch gelungen, Gramin in einer nicht graminproduzierenden Gerstensorte herzustellen und umgekehrt, die Graminproduktion in einer graminproduzierenden Gerstensorte durch Genom-Editierung zu unterbinden“, sagt Sara Leite Dias, ebenfalls Erstautorin der Studie und von der International Max Planck Research School geförderte Wissenschaftlerin am IPK.
„Die Ergebnisse ermöglichen die Herstellung von Gramin in Organismen, die eigentlich nicht die Fähigkeit haben, es selbst zu synthetisieren“, erklärt John D‘Auria. „Umgekehrt kann Gramin nun aus Gerste und anderen Gräsern eliminiert werden, um die Toxizität für Wiederkäuer zu verringern“, sagt der IPK-Wissenschaftler. „Unter dem Strich bilden die Ergebnisse die Grundlage für die Verbesserung der Gerste, um ihre Resistenz gegen Schädlinge künftig weiter zu erhöhen, ihre Toxizität für Wiederkäuer zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu leisten.“
.
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
Heute ist das QS World University Ranking by Subject 2024 veröffentlicht worden. In dem internationalen Fächerranking platziert sich die Leibniz Universität Hannover mit dem Fach Philosophie in der Ranggruppe 101 bis 150. Der Bildungsdienstleister QS (Quacquarelli Symonds) hat dieses Jahr rund 5.000 Universitäten in insgesamt 55 Fächern bewertet und die Ergebnisse von über 1.500 Universitäten veröffentlicht.
„Das starke Abschneiden des Fachgebietes Philosophie bestätigt unseren Weg: In den vergangenen Jahren haben wir die Philosophie durch herausragende Berufungen konsequent weiterentwickelt und somit die internationale Sichtbarkeit der LUH in diesem Fachgebiet deutlich gestärkt“, sagt LUH-Präsident Prof. Dr. Volker Epping. Diese Stärke fließt ein in den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion, der aktuell einen eigenen Forschungsbau erhält: Das Forum Wissenschaftsreflexion entsteht in der Nordstadt und feiert im Juni 2024 sein Richtfest. Es wird künftig die beteiligten Institute und Zentren unter einem Dach zusammenführen und die Weichen stellen, den Forschungsschwerpunkt zu einem europäischen Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung auszubauen.
Das Ranking betrachtet für die Bewertung der Hochschulen im Fach Philosophie vier Indikatoren, von denen der „Academic Reputation“ mit 75 Prozent die stärkste Gewichtung zukommt. Das gute Ergebnis der LUH im Fach Philosophie ist somit insbesondere auf die hohe Punktzahl in diesem Indikator zurückzuführen, wo sie über 60 Punkte erreicht. Auch in den beiden bibliometrischen Indikatoren schneidet die LUH hervorragend ab: Im Indikator „Citations“, der den Einfluss wissenschaftlicher Veröffentlichungen betrachtet, erreicht sie über 70 Punkte. Hinter den Punktzahlen der bibliometrischen Indikatoren stehen stark beachtete Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus dem Institut für Philosophie und dem Leibniz Center für Science and Society (LCSS).
Die gesamten Ranking-Ergebnisse: https://www.topuniversities.com/subject-rankings.
Mehr Informationen zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsreflexion: https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte/wissenschaftsreflexion.
.
15.04.2024: Vizepräsidentin verleiht Lehrpreise
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
15.04.2024: Wirtschaft verstehen, Wissen schaffen - Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der LUH wird 50 Jahre alt
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Sie begeistern die Studierenden und vermitteln fundiertes Wissen so, dass es Spaß macht: Sechs Lehrende sind jetzt für ihre Arbeit mit dem Lehrpreis 2023 der Leibniz Universität Hannover (LUH) ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Julia Gillen, LUH-Vizepräsidentin für Bildung, übergab die Preise während des Tages der Lehre am 9. April an Prof. Dr. Jana Gohrisch, Dr. Lennard Zyska, Dr. Tina Otten, Prof. Dr. Jutta Papenbrock, Prof. Dr. Sophia Rudorf und Prof. Dr. Thomas Seel. Die Lehrpreise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jedes Jahr in den Kategorien Motivation und Inspiration, Strategie und Transfer sowie Professionalisierung und Lehrkultur verliehen.
Kategorie 1: Motivation und Inspiration
Prof. Dr. Jana Gohrisch ist seit 2006 Professorin für Englische Literaturwissenschaft am Englischen Seminar der LUH. Die Rückmeldung der Studierenden zu ihren Lehrveranstaltungen sind positiv. „Die außerordentliche Bandbreite an Schwerpunkten, vornehmlich im Rahmen anglophoner und postkolonialer Literatur- und Kulturwissenschaft, reizt die Studierenden immer wieder aufs Neue ihr persönliches Bewusstsein und wissenschaftlich-forschendes Interesse zu hinterfragen.“, heißt es in einer Begründung für die Nominierung.
Seit November 2022 ist Dr. Lennard Zyska als PostDoc am Institut für Öffentliche Finanzen beschäftigt. Seine Lehrveranstaltung bewerten die Studierenden ausgesprochen positiv: Dr. Zyska sei ein exzellenter, enthusiastischer Lehrer, der innovative und anspruchsvolle Kurse anbiete, einen offenen, kooperativen Umgang und aktive Beteiligung und Zusammenarbeit fördere, die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden sehr gut berücksichtige, und eine inklusive Lernatmosphäre und positive Lernerfahrung für alle Studierenden schaffe.
Dr. Tina Otten arbeitet seit 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Literaturdidaktik und im Bereich Sprachdidaktik am Deutschen Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen bewerten die Studierenden durchgängig positiv: „Frau Otten ist eine super Dozentin. Man hat das Gefühl, dass einem auf Augenhöhe begegnet wird und dass ihr viel daran liegt, dass wir etwas für unsere berufliche Laufbahn lernen. Tolles Seminar mit wertvollem Inhalt.“
Kategorie 2: Strategie und Transfer
Prof. Dr. Jutta Papenbrock ist seit 2010 Professorin an der LUH. Darüber hinaus ist sie Studiendekanin an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Austauschkoordinatorin für Biologie und Pflanzenwissenschaften und EULiST-Beauftrage der Fakultät. Die Studierenden schätzen die Einbindung von internationalen Aspekten in die Lehre: „Prof. Papenbrock bietet nicht nur ein geeignetes Umfeld für ihre Studierenden, sondern vermittelt auch Themen von internationaler Relevanz und fördert den Technologietransfer auf verschiedenen Ebenen. Sie hat weniger industrialisierte Länder beim Wissenstransfer zu Themen von nationaler und internationaler Bedeutung unterstützt.“
Kategorie 3: Professionalisierung und Lehrkultur
Seit April 2021 ist Prof. Dr. Sophia Rudorf Professorin am Institut für Zellbiologie und Biophysik. „Ich nominiere Frau Prof. Dr. Sophia Rudorf aufgrund ihres vom MWK im Rahmen von InnovationPlus geförderten und in 2023 sehr erfolgreich durchgeführten Lehrprojekts zur Einführung der hoch leistungsfähigen Programmiersprache „Julia“ in der Lehre. In einem eng verzahnten, vielschichtigen Lehrkonzept wurden Studierenden Programmierkenntnisse vermittelt und sie zu Projektleitenden ihres eigenen, praxisnahen open-source-Projekts ausgebildet,“ heißt es in einem Feedback zu ihrer Arbeit.
Im April 2023 hat Prof. Dr. Thomas Seel die Leitung des Instituts für Mechatronische Systeme übernommen. Ein Student schreibt über seine Veranstaltungen: „Innovatives Lehrkonzept durch unter anderem Einbau von interaktiven Fragen per eduvote in den Veranstaltungen, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anregen. In den Vorlesungen wird ein tiefes Verständnis der Materie durch viele Beispiele und Fragen unter Anwendung von Transferwissen geschaffen.“
Alle Mitglieder der LUH durften jemanden von den Professorinnen, Professoren und Beschäftigten aus dem Wissenschaftlichen Mittelbau für die Auszeichnung vorschlagen. Insgesamt wurden 190 Lehrende der LUH für den Preis nominiert. Über die Vergabe entschieden hat ein Auswahlbord, dem vier Studierende, zwei Lehrende und zwei Mitarbeitende aus lehrunterstützenden Bereichen angehören. Den Vorsitz hat der Präsident der LUH, Prof. Dr. Volker Epping. Die Vizepräsidentin für Bildung, Pof. Dr. Julia Gillen, berät das Gremium.
Mehr unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/lehre/lehrpreis/.
.
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
Was heutzutage in der Eigenverantwortung der Universitäten liegt, bedurfte in den siebziger Jahren noch eines Gesetzes: Am 29. März 1974 wurde mit der Verkündung des „Gesetzes über die Errichtung einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Hannover“ der Grundstein für die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Leibniz Universität Hannover (LUH) gelegt. Die Fakultät wuchs rasch und hat seit inzwischen 30 Jahren auf dem Conti-Campus ihre Heimat gefunden.
Jetzt haben zahlreiche Mitglieder der Fakultät, Alumni und Gäste bei einem Festakt am 10. April den 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert. Neben Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Stadt Hannover sprach Festrednerin Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Alumna der Fakultät, zum Thema „Demokratie braucht Daten“. Eine Zeitreise in die Gründungszeit unternahm Prof. Dr. em. Lothar Hübl, früherer Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Rektor a. D. der Universität Hannover, in seinem Vortrag zur „Studiensituation der siebziger Jahre“. Auch Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der LUH, sowie Prof. Dr. Maik Dierkes, Dekan der Fakultät, gaben aus ihrer Perspektive einen Abriss der Fakultätssituation früher und heute. Zudem teilten Martina Dannenbring, Mitarbeiterin im Studiendekanat, und die Studierenden Ana-Lena Bode und Madita Kölbel ihre Sicht auf die Fakultät.
Der Themenbereich hat in Hannover eine lange Tradition. Einzelne wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an der Polytechnischen Schule zu Hannover gab es bereits im Jahr 1872. 1974 startete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der damaligen Technischen Universität Hannover mit 170 Studierenden. Sie wuchs sehr schnell: Die zunächst erwartete Zahl von 600 bis 700 Studierenden war schon wenige Jahre nach der Gründung überschritten. Zunächst war die Fakultät im so genannten Nebenstandort in der Wunstorfer Straße untergebracht. Zusätzliche Raumanmietungen kamen hinzu, bis das Land vor 30 Jahren das ehemalige Verwaltungsgebäude der Continental AG erwarb und die Fakultät im dortigen ehemaligen Direktionstrakt ansässig wurde.
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Hannover war eine der ersten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die die Kombination von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre angeboten hat. Der Gründungsgeneration war es außerordentlich wichtig, beide Teildisziplinen in einem Studiengang zu vereinen. Viele renommierte Professorinnen und Professoren aus der Anfangszeit blieben der LUH lange Jahre, zum Teil auch in weitreichenden Funktionsämtern, verbunden, etwa Prof. Dr. Lothar Hübl, Prof. Dr. Ursula Hansen oder Prof. Dr. Arnold Picot.
Heute forschen und lehren 25 Professorinnen und Professoren und etwa 120 Doktorandinnen und Doktoranden an 21 Instituten. Mehr als 16.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihr Studium abgeschlossen, knapp 800 haben promoviert. 2023 bildete die Fakultät etwa 3.500 Studierende in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsingenieur und Arbeitswissenschaft aus. Die Forschungsschwerpunkte sind „Financial Markets and the Global Challenges“, „Gesundheit und Bevölkerung“ und „Nachhaltige Globalisierung: Umwelt, Handel, Migration und Entwicklung“. Die Fakultät ist national und international sehr gut vernetzt.
Die Forschungsaktivitäten stehen in enger Wechselwirkung mit der Lehre – Ziel ist eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Lehre. Bereits im Bachelorstudium ist eine Vertiefung auf Spezialisierungsrichtungen möglich, die dann im Masterstudium weiterverfolgt werden können. Im Masterstudium wird auch ein durchgängig englischsprachiges Studium angeboten. Die Studienprogramme decken alle wichtigen Gebiete der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Statistik und der empirischen Wirtschaftsforschung ab.
.
15.04.2024: Land und Bund eröffnen Niedersachsen Standort für die Quantentechnologie-Industrie
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.
Am 10. April 2024 wurde in den ehemaligen Rolleiwerken Braunschweigs Niedersachsens neuer Standort für Technologietransfer in den Quantentechnologien eröffnet: Der HighTech-Inkubator des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS-HTI). Auf rund 500 Quadratmetern neuer Büro- und Laborfläche treffen Startups, exzellente Forschungseinrichtungen und künftig auch etablierte Unternehmen zu einem kontinuierlichen Ideenaustausch aufeinander. Für einen starken Impuls in die Region bündelt der QVLS-HTI Förderungen von Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land (Niedersächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur sowie für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung) sowie die wissenschaftliche Expertise der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der Leibniz Universität Hannover (LUH).
Durch eine initiale Förderung für Niedersächsische Hightech-Inkubatoren in Höhe von über 4 Millionen Euro sind bereits 11 Startups mit dem QVLS-HTI verbunden. In den ehemaligen Rolleiwerken knüpft der QVLS-HTI an eine lange industrielle Tradition an: Wo vor fast 100 Jahren weltberühmte Kameras vom Band gingen, arbeiten jetzt junge Talente wie die Ausgründung QUDORA, einem Spin-Off der PTB und der LUH, am Chip des Niedersächsischen Quantencomputers. Damit Startups wie QUDORA ihre technologische Reife demonstrieren können, hat der HTI 1,5 Millionen in die technische Ausstattung des Standorts investiert. Neben einem DeepTech-Makerspace inklusive 3D-Druckern liegt dabei ein Schwerpunkt auf empfindlichen quantenoptischen Experimenten.
Am konstanten Erfolg des QVLS HighTech-Inkubator sind zwei Großprojekte der niedersächsischen Allianz Quantum Valley Lower Saxony beteiligt. Förderungen von Land- und Bund greifen hier ineinander, um in einer forschungs- und wirtschaftsstarken Region das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu heben:
Mit insgesamt 25 Millionen Euro aus zukunft.niedersachsen, dem Förderprogramm von des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung, wird das Projekt QVLS-Q1 zur Realisierung eines Quantencomputers für fünf Jahre bis zum Jahr 2025 unterstützt. Seit 2022 und bis zum Jahresende 2024 stellt das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung die notwendigen Mittel für den QVLS-HTI bereit. Mit 4,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Gründung und Weiterentwicklung von insgesamt 11 Quantentechnologie-Startups, die die wissenschaftliche Exzellenz der Region in den Markt bringen. Der im Jahr 2022 gestartete Inkubator wurde von Anfang an darauf angesetzt, jungen Deep-Tech Unternehmen gemeinsam genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt in den Rolleiwerken eröffnet werden. Eingebunden in das Ökosystem des Quantum Valley Lower Saxony steht hier anhaltender Technologietransfer im Mittelpunkt
Aus der gemeinsamen Anschubfinanzierung in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft durch das Land konnte jetzt eine Bundesförderung erzielt werden. Ab Januar 2025 ist der QVLS-HTI dann der neue Knotenpunkt für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer ersten Phase mit rund 15 Millionen Euro geförderte Zukunftscluster QVLS iLabs. Im Zukunftscluster arbeiten Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um die enormen Chancen der Quantentechnologien in Niedersachsen zu entfalten. Der HighTech-Inkubator öffnet sich dann für weitere Startups und Unternehmen, die bis an die Grenzen der Physik gehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Während Startups für innovative Ideen und Impulse stehen, braucht es für die Skalierung dieser Ideen häufig Unternehmen mit größeren Kapazitäten. Die iLabs sichern langfristig die Zusammenarbeit von der Entwicklung von Schlüsseltechnologien bis zur Anwendungs- und Produktentwicklung.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prof. Sabine Döring: „Quantentechnologien sind Schlüsseltechnologien der Zukunft mit enormem Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen vom quantencomputergestützten Design neuer Wirkstoffe bis hin zu abhörsicherer Kommunikation. Damit dieses Potenzial und die großen Chancen der Technologie Wirklichkeit werden, stellt die Bundesregierung gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen rund drei Milliarden Euro bereit. Das Quantum Valley Lower Saxony und der Zukunftscluster QVLS-iLabs sind hierfür außerordentlich wichtig. Gemeinsam bauen wir hier ein Innovationsökosystem mit glänzender Zukunft auf. Start-Ups spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Im neu eröffneten High Tech Inkubator erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um im internationalen Innovationswettbewerb zu bestehen.“
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs: „Der QVLS HighTech-Inkubator ist ein toller Erfolg für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen: Dass aus der Anschubfinanzierung durch das Land diese wichtige Unterstützung durch den Bund resultiert, belegt die Relevanz unserer Forschung über Niedersachsen hinaus. Der QVLS HighTech-Inkubator zeigt beispielhaft auf, dass Grundlagenforschung und Start-ups im Bereich der Quantentechnologien ideal zusammenpassen und eine gezielte Zusammenarbeit große Perspektiven für den Transfer junger Wissenschaftsbereiche in Gesellschaft und Wirtschaft birgt.“
.



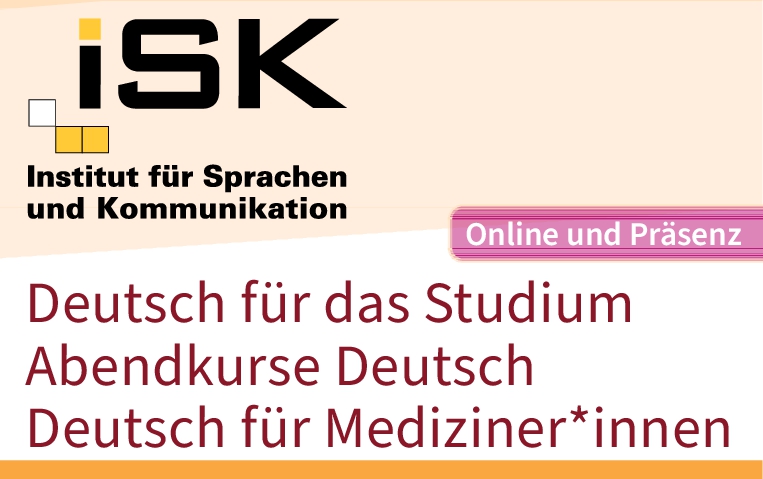
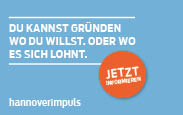
.jpg)










